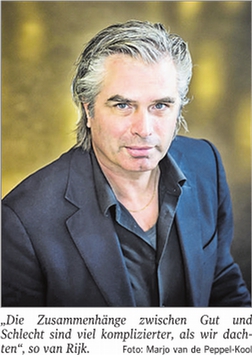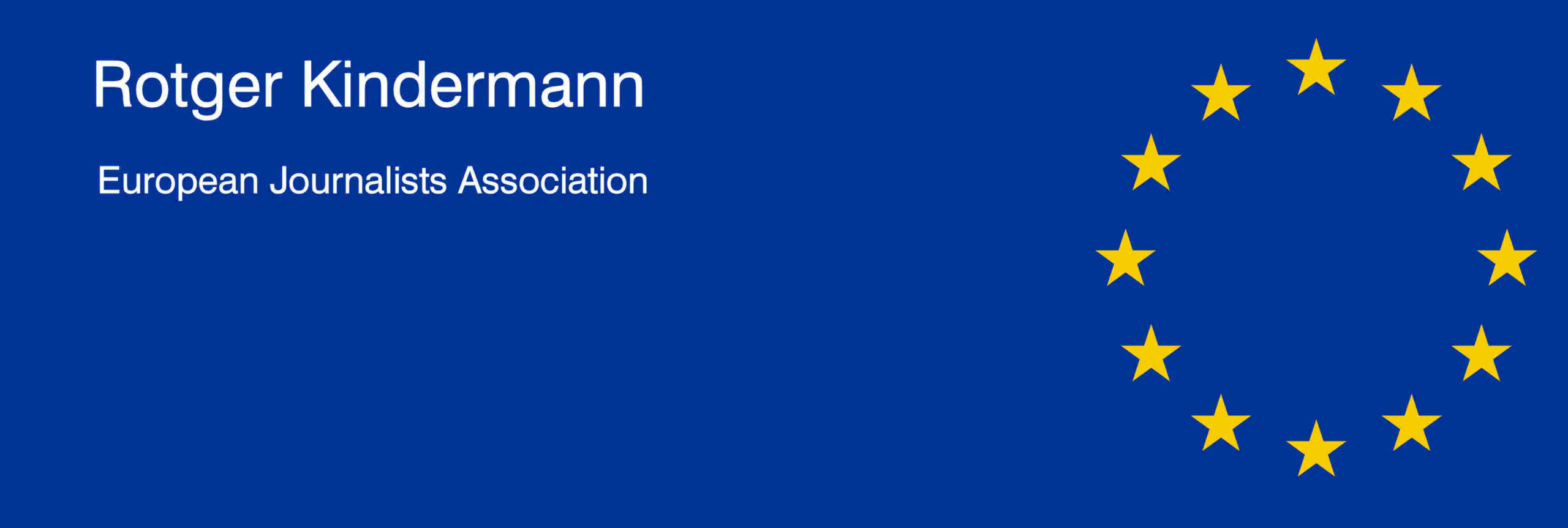Giacometti und Ernst: Eine künstlerische Seelenverwandtschaft
Der teuerste Bildhauer der Auktionsgeschichte: Giacomettis Erfolg nach der Trennung von den Surrealisten
Von Rotger Kindermann
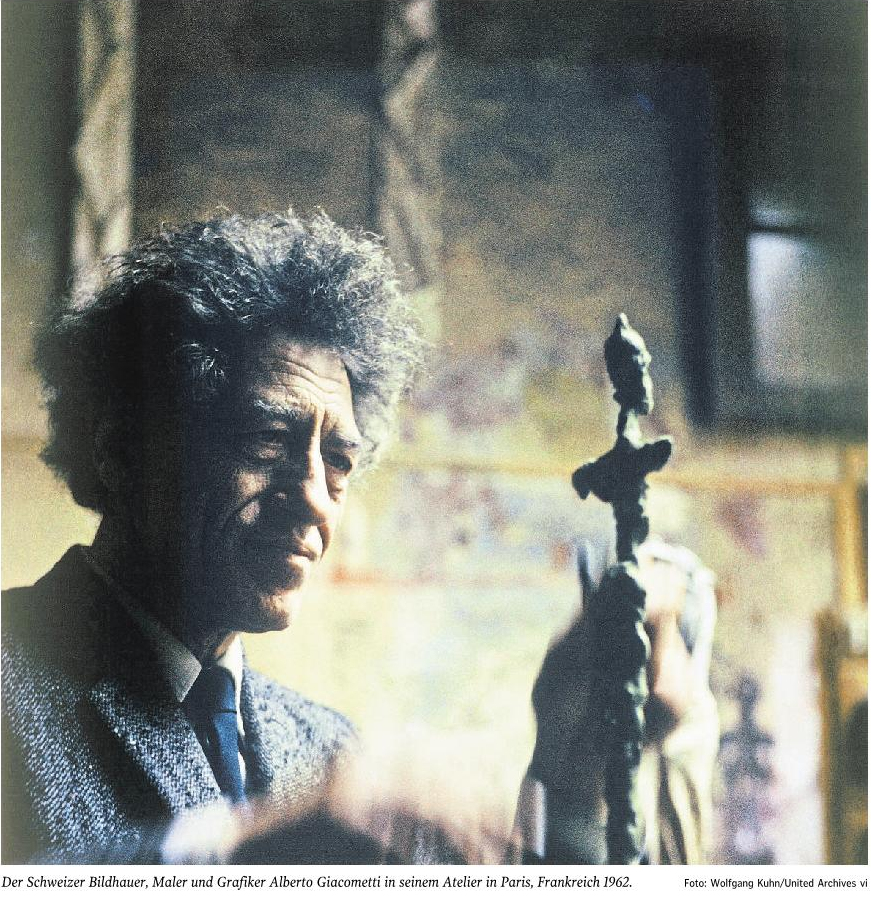
Die Präsentation zeigt zahlreiche Hauptwerke des Künstlers aus den Jahren 1925 bis 35, darunter Le Couple (1926), Femme culliére (1927), Boule suspendue (1930), Objet désagréable (1931) oder die Gestaltung Schweigevogel, ein transparenter Käfig, in dem zwei aus Kugeln und Stäben geformte Wesen in einer Kampfszene verbunden werden. Diese Skulptur ist ein typisches Zeugnis von Giacomettis innerer Rebellion gegen reale künstlerische Konventionen, hier werden seine Träume und Ängste zum Ausdruck gebracht.Wie ein absoluter Kontrast zu Giacomettis späten stiftförmigen Bronzefiguren wirken die ausgestellten Scheibenplastiken, obwohl auch sie – von der Seite betrachtet – als einfache, reduzierte Linie erscheinen. Die Faszination für Steinarbeiten teilte Giacometti mit Max Ernst, mit dem er 1934 in Zürich gemeinsam ausstellte. Ein Jahr später lud er ihn in das Haus seiner Schweizer Familie in Maloja ein, wo beide bald „vom plastischen Fieber befallen wurden“. Auf ihren Wanderungen schwärmten sie über von Naturgewalten geformte Findlinge und Felsblöcke, sammelten kleinere Exemplare, um sie zu Steinskulpturen zu bearbeiten und zu bemalen. Diese Phase gemeinsamen Schaffens, die mit einer behutsamen Abkehr von surrealistischen Kontrasten und Verfremdungen einherging, dokumentiert das Museum mit zahlreichen Fotos und Werken von Ernst aus der eigenen Kollektion. Den Kuratorinnen Laura Braverman (Fondation Giacometti, Paris) und Dr. Friederike Voßkamp (Max Ernst Museum) war es ein besonderes Anliegen, die Arbeiten der beiden Künstler in einen direkten Dialog treten zu lassen und ihre persönliche und künstlerische Seelenverwandtschaft aufzuzeigen.
Der teuerste Bildhauer


Dem eindrucksvollen Gesamtwerk Giacomettis – nach dessen Trennung vom Kreis der Surrealisten – würde man keinesfalls gerecht, wollte man seine besonders erfolgreiche Nachkriegsperiode unbeachtet lassen. Denn mit seinen stabartigen Figuren erreicht Giacometti völlig neue Dimensionen, wird in Kunstkreisen en vogue und wurde später „der teuerste und einflussreichste Bildhauer der Auktionsgeschichte“.
Ohne Frage wird in Brühl eine repräsentative Auswahl gezeigt, darunter die bekannten Vier Frauen auf einem Sockel aus dem Jahr 1950. Mit seinen filigranen, fadenähnlichen Gestalten bricht Giacometti fast 60 Jahre nach seinem Tod alle Rekorde: L’homme au doigt (Mann mit Fingerzeig) ist bislang die teuerste Skulptur der Welt, die im Mai 2015 bei Christie’s für 141,3 Millionen Dollar versteigert wurde. Die hageren Geschöpfe, mehrfach von einer Art Käfig umrahmt, die von auffallenden Überlängen der Extremitäten und Köpfe geprägt sind, beeindrucken bis heute ein breites Publikum. Surrealistische Einflüsse und Visionen lassen sich auch in seinem Spätwerk durchaus erkennen. Die spindeldürren Figuren „sind höchst rätselhaft, sie wirken verspielt und bedrohlich zugleich“, sagt Laura Braverman.Die Ausstellung im Max Ernst Museum zeigt rund 70 Werke, neben den Skulpturen auch Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken von Giacometti, die größtenteils von der Fondation Giacometti in Paris zur Verfügung gestellt wurden. Diese gemeinnützige Organisation verfügt nicht nur über zahlreiche Werke des Surrealisten, sondern verwaltet auch das Archivmaterial des Künstlers, darunter seine komplette Korrespondenz, Fotos, seine persönliche Bibliothek, Ausstellungskataloge oder Original-Kupferplatten. Auf diesem Fundus basierend gelingt es dem Museum, das vielfältige Wirken zweier Weltkünstler darzustellen und die Besucher auf
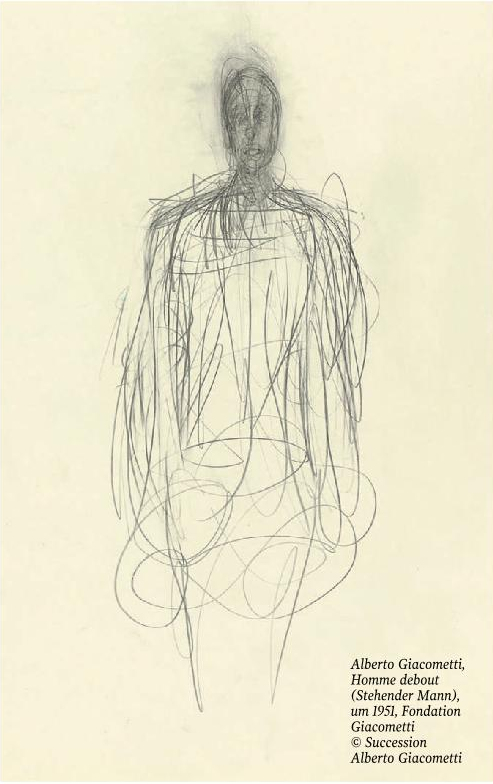
Brühl, der Geburtsort von Max Ernst, liegt zwischen Köln und Bonn. 2005 wurde der alte „Brühler Pavillon“, ein ehemaliges Ausflugslokal in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schloss Augustusburg, zu einem Museum um- und ausgebaut. Das Max Ernst Museum präsentiert das künstlerische Schaffen dieses Dadaisten und Surrealisten in einem Überblick. Bis 15. Januar 2025 dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr.www.maxernstmuseum.lvr.de
eine spannende Entdeckungsreise durch ihre „surrealistische Ideenwelt“ mitzunehmen. Zur Ausstellung erscheint ein reich illustrierter, dreisprachiger Katalog (Deutsch, Englisch, Französisch), der die surrealistische Welt erklärt und die ausgestellten Kunstwerke präsentiert.
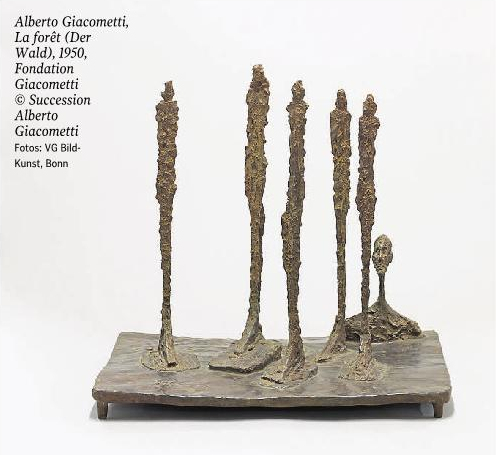

Zeiten und Räume – eine inspirierende Reise durch die Kunstgeschichte
Von der Heydt Museum präsentiert Klassiker der Sammlung
Von Rotger Kindermann
Mit über 2.000 Gemälden, 500 Skulpturen, 800 Fotografien und 30.000 grafischen Blättern verfügt das Wuppertaler Von der Heydt Museum über eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Deutschlands. Ihr systematischer Aufbau begann in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts und dauert bis heute an. Mit der jetzt gestarteten Ausstellung „Zeiten und Räume – Klassiker der Sammlung“ lädt das Museum dauerhaft ein, seine hochkarätigen Bestände anhand einer präzisen Auswahl neu zu entdecken. Die Kuratorin Anna Storm hat eine Art Reiseführer zusammengestellt, der durch die wichtigen Epochen der europäischen Kunstgeschichte führt – vom 17. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre.
Der erste Kunstmarkt
Einer der frühen Sammlungsschwerpunkte des Museums war die niederländische bzw. flämische Malerei, wie die Werke von Jacob van Ruisdael und Frans Snyders dokumentieren. Sie werden im ersten der insgesamt neun Räume gezeigt. In den Niederlanden entstand damals der erste Kunstmarkt der Welt, angetrieben durch den kolonialen Überseehandel. Die wohlhabende Kaufmannschaft stellte ihren Reichtum durch den Ankauf von Kunstwerken zur Schau. In dieser als „Goldenes Zeitalter“ bezeichneten Epoche schufen in der aufstrebenden Republik ca. 700 Malerwerkstätten jährlich rund 70.000 Gemälde. Passend dazu werden Stillleben und „Sehnsuchtsmotive“ der deutschen Romantik aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgestellt, blühende italienische Landschaften oder Szenen aus der Antike. Die nächste „Raumbetrachtung“ führt in das Frankreich zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Raum 3), wo ebenfalls die Darstellung heimischer Landschaften die Künstler motiviert. Im Wald von Fontainebleau, etwa 50 km entfernt von Paris, malen sie das bäuerliche Leben und wenden sich hin zur Natur. Ihre als Impressionismus deklarierte Freiluftmalerei erzeugt wirkungsvolle optische Eindrücke, sie spielt mit den Effekten des Lichts und seinem Einfluss auf Farben. Mit Gemälden von Cézanne, Manet, Monet, Renoir, Signac oder Sisley ist dieser Raum auffallend prominent besetzt. Ein Beispiel, wie faszinierend die Wirkung eines Bildes sein kann, liefert Claude Monet, dessen impressionistischer Pinselstrich das Örtchen Vétheuil nahe Paris abbildet. Das Wasser der Seine spiegelt im weichen Sonnenlicht die Dorfkulisse. Je weiter sich der Betrachter vom Bild entfernt, desto klarer erkennbar werden die Konturen der Häuser und Höfe. Allein diesen Raum zu erleben, macht den Besuch der Ausstellung lohnenswert.
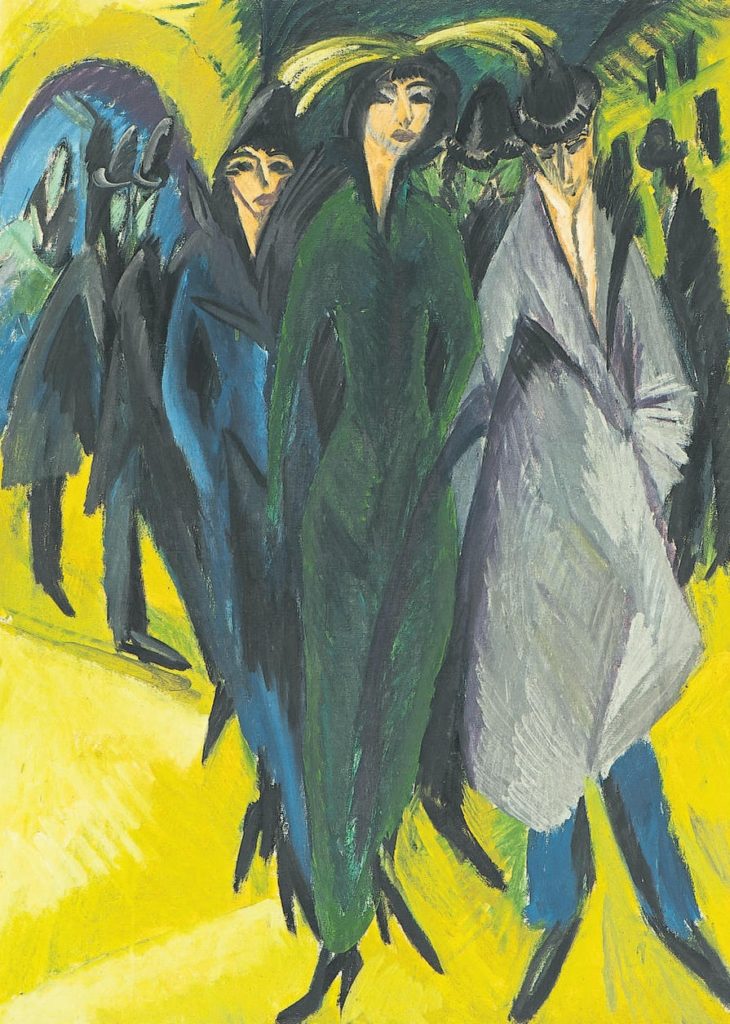
Ernst Ludwig Kirchner, Frauen auf der Straße, 1914 Öl auf Leinwand, 126 x 90 cm. Fotos: Von der HeydtMuseum Wuppertal
Von Wuppertal nach Worpswede
Es liegt nahe, dass Maler, die das heutige Wuppertal hervorbrachte, in der neuen Sammlung eine herausgehobene Rolle spielen (Raum 4). So zum Beispiel Hans von Marées, der 1834 in Elberfeld geboren wurde und zu den bedeutendsten Künstlern des 19. Jahrhunderts gerechnet wird. Das Von der Heydt Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung seiner frühen Werke, sechs davon werden gezeigt. Marées zählt neben Arnold Böcklin und Anselm Feuerbach sowie dem Bildhauer Adolf von Hildebrand zu den sogenannten „Deutschrömern“, einem Kreis von Künstlern, die nach Italien reisten und sich von der Kunst der italienischen Renaissance inspirieren ließen. Nicht nur die großen Städte wie Paris, Berlin oder München waren Kristallisationspunkte der europäischen Kunstszene, aktive Künstlerkolonien entstanden Ende des 19. Jahrhunderts auch im ländlichen Raum wie zum Beispiel in Worpswede unweit von Bremen. Hier wirkte Paula Modersohn-Becker, eine Wegbereiterin des Expressionismus. Unmittelbar nach ihrem frühen Tod 1907 erwarb der Wuppertaler Kunstsammler August von der Heydt insgesamt 28 Gemälde aus ihrem Nachlass, von denen sich heute noch 21 im Bestand des Museums befinden. Sechs Werke von ihr zeigt die aktuelle Ausstellung in Raum 5. Sie war eine der wenigen Frauen, denen es gelang, sich in der männlich dominierten Kunstszene einen Namen zu machen. Eine Grafik in der Ausstellung zeigt, dass nur 6,5 Prozent des gesamten Kunstbestandes des Von der Heydt von Künstlerinnen stammen. Auch die Herkunftsländer (Räume) werden statistisch dokumentiert.
Aufbruch am Staffelsee
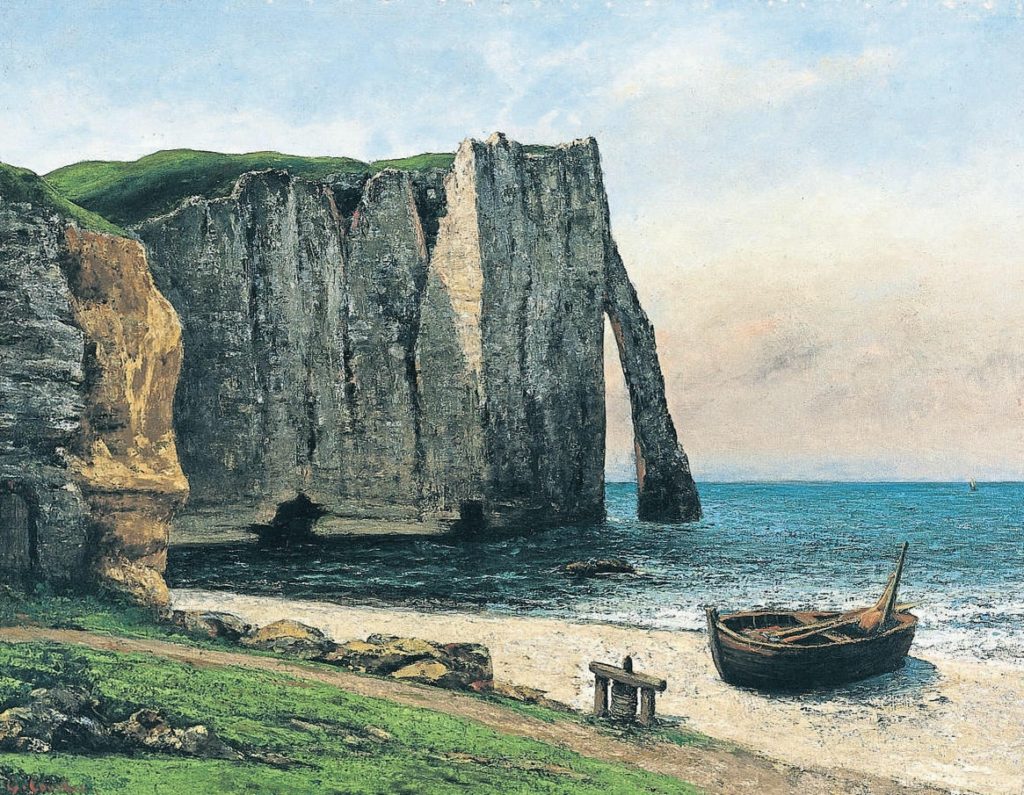
Gustave Courbet, Die Steilküste bei Étretat, um 1869 Leinwand, 93 x 114 cm.
Prominent vertreten sind in Raum 6 Künstlerinnen und Künstler, die unter dem Namen „Der Blaue Reiter“ einen unverwechselbaren Beitrag zum Expressionismus geleistet haben – wie Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Franz Marc, August Macke, Wassily Kandinsky oder Emil Nolde. Auch in diesem Fall handelt es sich eher um eine Künstlerkolonie, die sich im Sommer 1908 in Murnau am Staffelsee, 70 km südlich von München, zu einer kurzen aber höchst produktiven Phase zusammengefunden hatte. Eine andere entscheidende Variante des deutschen Expressionismus dokumentiert (Raum 7) die Künstlergruppe „Die Brücke“, die ab 1905 in Dresden entstand. Angeregt durch Munch, Van Gogh und Gauguin entwickelten sie eine radikale Bildsprache, die vor allem in großflächigen vielfarbigen Kompositionen Ausdruck fand. Ausgestellte Werke von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl SchmidtRottluff zeigen den neuen Aufbruch.
Die menschliche Figur als Schlusspunkt
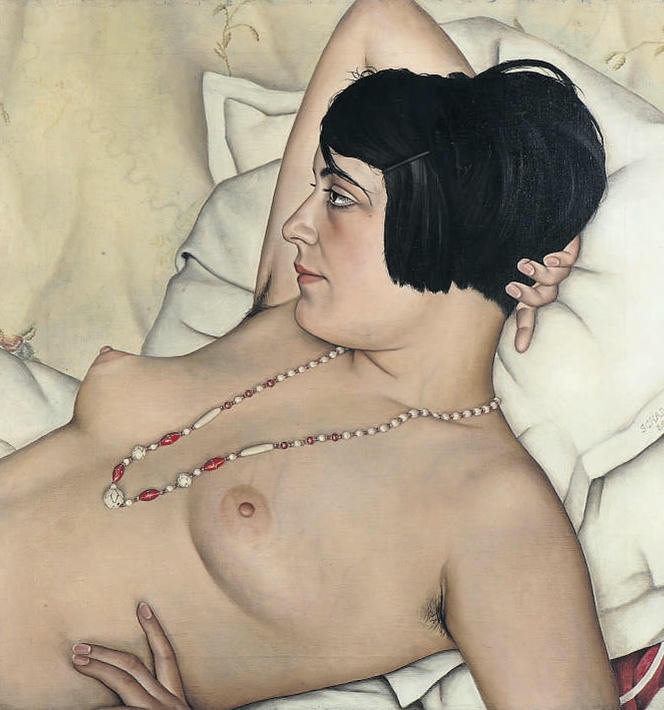
Christian Schad, Halbakt, 1929, Leinwand, 55,5 x 53,5 cm
In Europa vollziehen sich nach dem Ersten Weltkrieg enorme gesellschaftliche Veränderungen, die sich auf die Kunstszene auswirken. Dem Aufbruch folgt ein eher nüchterner Blick, wie er sich im Bauhaus-Stil ausdrückt. Die Figuren und Motive von Gerd Arentz oder Otto Dix (Raum 8) zeugen von einer vereinfachten Formensprache, setzen aber auch politische Missstände ins Bild. Als Schlusspunkt zeigt das Museum eine repräsentative Auswahl aus seiner Skulpturensammlung. Dabei steht der menschliche Körper im Vordergrund und der wird von Hans Arp, Auguste Rodin oder Alberto Giacometti höchst unterschiedlich gestaltet. So dokumentiert Raum 9 die Vielgestaltigkeit von figürlicher Kunst, die beim Besucher die Vorstellungskraft beflügelt. Eingebettet in die Ausstellung „Zeiten und Räume“ sind Werke von Lothar Baumgarten (1944-2018), die erstmals nach dem Tod des ehemaligen Beuys-Schülers und Völkerkundlers unter dem Titel „Land oft he Spotted Eagle“ gezeigt werden. Die Foto-Arbeiten und Installationen (Raum 2) stammen aus der Sammlung Lothar Schirmer, der den Künstler persönlich kannte. Sie schlagen Brücken in andere Kulturen und stellen die Frage nach dem Eigenen und dem Fremden auf vielfache Weise. Bestimmte Bildkomponenten wie die Vogelfeder ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Mit diesem überraschenden Ausflug in die Moderne wird die Ausstellungschronologie aufgelockert und Baumgarten einem breiteren Museumspublikum bekannt gemacht.
Audioguide mit Kramer und Krassnitzer
Eine besondere Premiere bietet der Audioguide zu „Zeiten und Räume“. Dafür konnte das Von der Heydt Museum das Schauspielerpaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer gewinnen. Die beiden leben in Wuppertal (ebenso in Tirol) und sind der Stadt und seinem Museum sehr verbunden. Kramer ist gebürtige Wuppertalerin und kennt das Museum seit ihrer Kindheit. Ihre Eltern sind freischaffende Maler. Kramer und der aus Österreich stammende Krassnitzer zählen zu den bekanntesten deutschen Fernsehgesichtern und überzeugten in zahlreichen Serien und Krimireihen. Die Beiden haben die Texte zu 21 Werken dieser Ausstellung gesprochen. Auswahl und Texte stammen von der Kuratorin Dr. Anna Storm.
Tickets im Online-Shop unter www.von-der-heydt-museum.de. Preis 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Familie 24 Euro.
Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, donnerstags auch bis 20 Uhr.
Öffentliche Führungen jeden zweiten Sonntag im Monat, 15:30 Uhr, Extraticket 4 Euro.

Verborgene Kunstperlen
an der belgischen Küste
Besuch im Permeke Museum und im Peire Haus, zwei zu Museen umgestalteten Wohnhäuser bedeutender belgischer Künstler
Von Rotger Kindermann
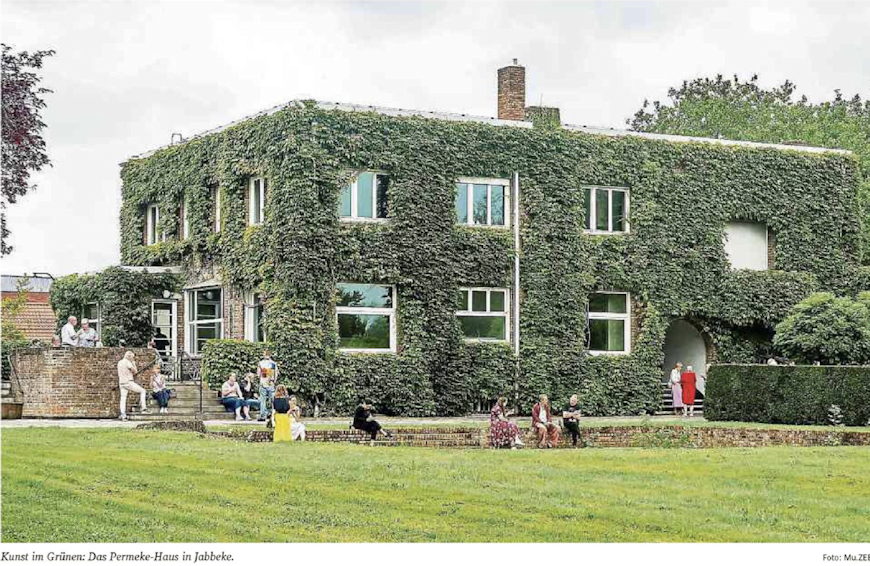
Kunst und Kultur sind untrennbar mit der belgischen Küste verbunden. Eine Reise dorthin ist für Kunstsinnige in diesem Jahr besonders lohnenswert. Vor allem, weil das spektakuläre Skulpturenfestival Beaufort“ dieses Jahr bereits zum achten Mal ans Meer zurückgekehrt ist. Bis zum 3. November kann man in diesem Freiluftmuseum wieder außergewöhnliche Kunstwerke erleben.
Überhaupt ist der 67 Kilometer lange Küstenstreifen von Knokke-Heist bis De Panne voll von großen und kleinen Kulturgütern, sehenswerten Museen- wie beispielsweise für moderne Kunst das Mu.ZEE in Ostende – oder verborgenen Perlen, wie die zu Museen umgestalteten Wohnhäuser bedeutender Künstler. In erster Linie bekannt sind darunter das EnsorHaus, ebenfalls in Ostende, und das Museum Paul Delvaux in Sint-ldesbald. Eine weitere Kostbarkeit findet man nun am Rande des Ortchens Jabbeke, wenige Kilometer westlich von Brügge, in einem von wildem Wein umwucherten Klinkerbau, der 1929 von Constanl Permeke errichtet wurde.
Dort lebte, malte und modellierte der Maler und Bildhauer bis zu seinem Tod im Jahr 1952. Ein umfassendes Werk wird heute zum größten Teil dem Expressionismus zugeordnet. Für Permeke waren Kunst und das ländliche Leben eng miteinander verknüpft. Es war seine wichtigste Inspirationsquelle. Dabei experimentierte er leidenschaftlich mit Materialien, bearbeitete seine Bilder mir Holzkohle und Terpentinfarbe. Pinsel und Spachtel waren seine Werkzeuge.
Humanistische Bildsprache
Constant Permeke war ein wahrer Weltenbummler in der Kunstszene. Bereits seine erste Teilnahme an der Biennale von Venedig im Jahr 1922 machte ihn international bekannt. 1930 sorgte seine Retrospektive im Brüsseler Palast der Schönen Künste mit Hunderten seiner Werke für Aufsehen. Bis kurz vor seinem Tod nahm er an großen Kunstausstellungen in Paris, Kairo, Stockholm und Sao Paulo teil. Nach den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs war die Sehnsucht nach seinen authentischen menschlichen Themen und seinem engen Verhältnis zur Natur besonders ausgeprägt. Permekes Kunst zeugt von einer recht eigenwilligen. originellen Bildsprache, die von einem tiefen Humanismus angetrieben wird.
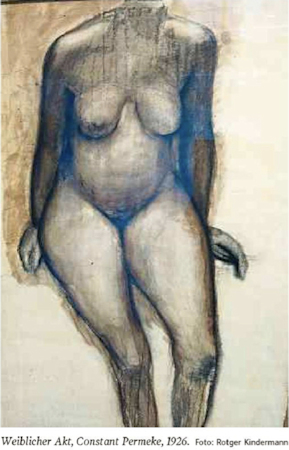
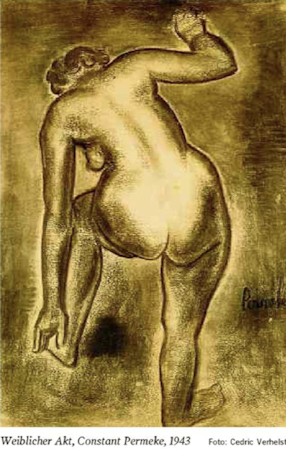
Nach einer längeren Renovierungsphase hat das Permeke Museum in Jabekke jetzt wieder seine Pforten geöffnet. Mit umfangreichen Arbeiten wurde das historische Wohnhaus in einen zeitgenössischen Museumskomplex verwandelt, der auch weitgehend barrierefrei zugänglich ist. Mit Wandtexten, Tabellen und Bildern wird sowohl sein familiäres Leben geschildert als auch sein künstlerisches Erbe gewürdigt. Im Wohnhaus wird künftig eine Dauerausstellung präsentiert, in dem angrenzenden Atelier sollen Permekes Werke zweimal jährlich in einen Dialog mit anderen Künstlern treten. Der große umliegende Garten wu.rde nach Permekes künstlerischer Vision ökologisch umgestaltet, die darin präsentierten von ihm gestalteten – Skulpturen zeugen von seiner tiefen emotionalen Verbindung zu Menschen und Natur.
Ort der Experimentierfreude
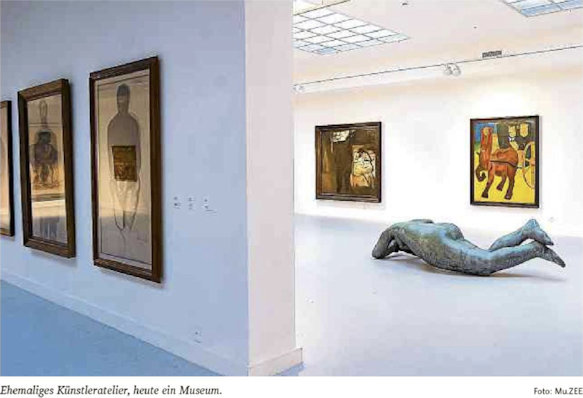
Ein anderes künstlerisches Kleinod verbirgt sich in einer kleinen Seitenstraße in Knokke-Dorp. Es ist das Wohnhaus samt Atelier, in dem Luc Peire (1916-1994) gelebt und gearbeitet hat. Auch dieser in Brügge geborene Künstler kam wie Permeke ursprünglich vom Expressionismus, entwickelte sich aber weiter in Richtung Konstruktivismus und Abstraktion. Ab den 1950er Jahren nutzte er für seine Bilder die Wirkung geometrischer Formen und Linien. bei seinen Druckgraphiken entwickelte er einen unverwechselbaren Stil, der sich durch harmonische, vertikal verlaufende Farbfolgen auszeichnet.
- Skulpturen zeugen von der
- tiefen emotionalen Verbindung des Künstlers zu Menschen und Natur.
Peires Experimentierfreude und künstlerisehe Hinterlassenschaft wird besonders erlebbar, wenn man sein rundum verspiegeltes Klangstudio betritt, das er im Garten errichten ließ. Während die vielfach sichtbaren Spiegelbilder den Körper in Spannung versetzen, geht von den hörbaren psychedelischen Klangelementen eine geradezu entspannende Wirkung aus. Ab Juli 2024 soll der gesamte Komplex für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Allein durch den weitgehend im Originalzustand erhaltenen Wohnbereich wird man gut ermessen können, wie der Künstler gelebt und gearbeitet hat. Jedenfalls erhält damit die belgische Küste eine weitere „Kunstperle“, die nicht länger verborgen bleiben sollte.

Permeke- Museum, Gistelsteenweg 341, B8490 Jabbeke, täglich geöffnet (außer dienstags) von 10 bis 17:30 Uhr, Eintritt 12 Euro. Luc Peire Haus, De Judestraat 64, B8- 8300 Knokke-Dorp

Sigmar Polke und Gerhard Richter im Glasmalerei-Museum
Von Mittelalter bis Moderne:
Das Deutsche Glasmalerei-Museum in Linnich
Von Rotger Kindermann
An der Rur, auf halber Strecke zwischen Aachen und Mönchengladbach liegt die Kleinstadt Linnich. Ein eher unauffalliger Ort mit etwa 13.000 Einwohnern – würde er nicht ein Museum beherbergen, das sich einem spektakulären Thema widmet: Das „Deutsche Glasmalerei-Museum“.
Eine ehemalige Getreidemühle wurde 1997 aufwendig um ein transparentes Ausstellungsgebäude erweitert, wo heute Werke dieser anspruchsvollen Technik von ihren Anfängen im Mittelalter bis hin zur zeitgenössischen Kunst gezeigt werden. Mit der 1857 gegründeten Glasmalerwerkstatt Dr. Oidtmann verfugt Linnich bei dieser Kunstrichtung über eine eigene Tradition, seine wertvolle Glasmalereisammlung stellte das Unternehmen anlässlich der Museumsgründung der Träger-Stiftung zur Verfugung. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf Glasgemälden des 20. und 21. Jahrhunderts.
Schätze mit vielen Parallelen
Seit November zeigt das Museum eine Sonderausstellung unter dem Titel Junge Rebellen – Polke, Richter & Friends, die sich dieser experimentellen Avantgarde im Spannungsfeld von Glaskunst, Malerei und Fotografie widmet. Die Schätze, die in Linnich gezeigt werden, haben ihre eigenen, ganz individuellen Geschichten: Nachdem im Archiv des Museums eine Fenster-Tür-Kombination von Sigmar Polke lange auf ihre Präsentation gewartet hatte, geriet auch Polkes bekanntes Kirchenfenster im Züricher Großmünster in den Blick. Dazu fand sich bei den Recherchen zur Ausstellung ein gleichwertiges Pendant: Die Entwürfe und Original-Probefenster von Gerhard Richter für seine Fenster im Südquerhaus des Kölner Doms. Sie lagerten fast vergessen in einem der Türme.
Auf der Spurensuche zu den Werken wurde so manche Parallele entdeckt. Beide sind Erstlingswerke in Bezug auf die angewandte Technik. Für seine Fenster im Großmünster von Zürich verzichtete Polke auf ein Honorar; das gilt ebenso für Gerhard Richter’s Fenster im Kölner Dom. Es sind Geschenke der Künstler an die Öffentlichkeit. Beide Kirchenfenster zeugen von einer tiefgründigen inneren Auseinandersetzung mit religiösen Themen und sie überzeugen durch eine expressive künstlerische Formen- und Farbsprache.
Hohe Ansprüche an die Technik
Für die Umsetzung beider Fenster wurden spezielle handwerkliche Techniken entwickelt. Das Museum veranschaulicht in der Sonderausstellung, wie Gerhard Richter experimentiert hat, um Licht, Farbe und Material perfekt zu kombinieren. In drei unterschiedlichen Modellen hat er dazu die kleinen Farbquadrate zusammengefügt, einmal mit Hilfe der klassischen Bleiverglasung, durch eine Glasverschmelzung und durch eine Verfugung mit Silikon, die schließlich zur Anwendung kam.
Auch Sigmar Polke setzte mit der Achatverglasung völlig neue Materialien ein, die höchste Anspruche an die technische Umsetzung verlangten. Dieser Mut zum Experiment zeichnet auch die Werke der beiden anderen Künstler (& Friends) aus, Manfred Kuttner und Konrad Lueg. Die Studienkollegen von Richter und Polke aus den 60er Jahren an der Düsseldorfer Kunstakademie gehörten zu dem rebellischen Quartett, das damals den etablierten Kunstbetrieb mit innovativen Kunstformen und Happenings auf mischte.
Faszinierender Gebrauchsgegenstand
Welche Inspiration für nachfolgende Generationen davon ausgeht, zeigen schließlich Arbeiten von vier jungen Künstlerinnen Laura Aberham, Undine Bandelin, Wanda Koller und Katja Mönch präsentieren sich mit Installationen aus Acryl und Glas. die neuen „Mut zur Rebellion“ aber nur in abgemilderter Form erkennen lassen. Einen repräsentativen Blick über die Entwicklung der Glasmalerei vermittelt die Dauerausstellung, die auf sieben versetzten Ebenen und insgesamt 1400 qm gezeigt wird. Allein sie lohnt eine Reise nach Linnich. Glas ist zwar nur ein Gebrauchsgegenstand, aber hier wird anschaulich, welche Faszination ihm zugrunde liegt.
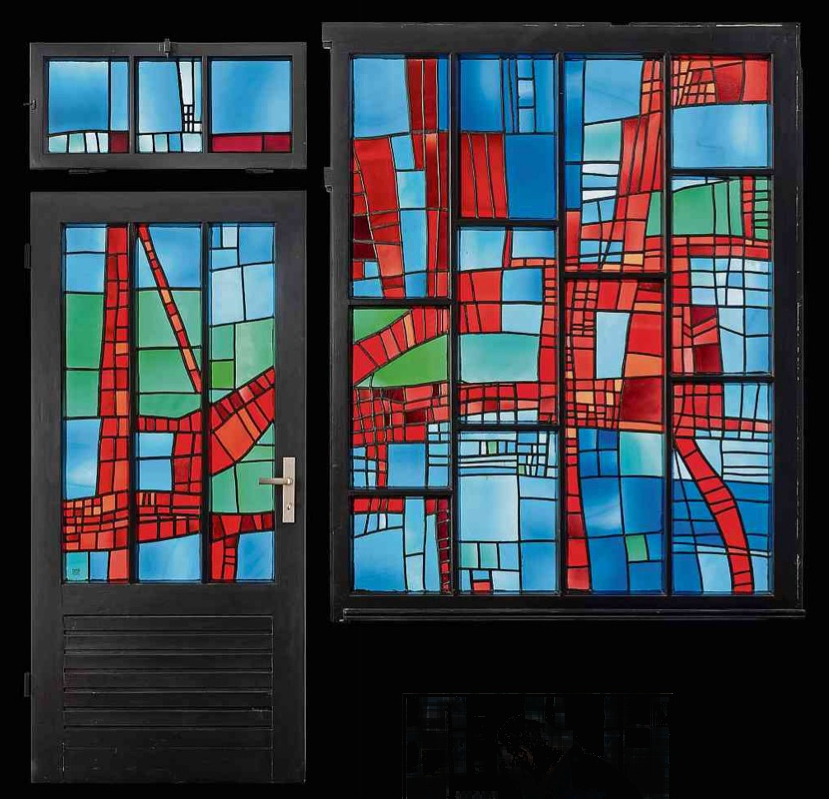
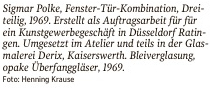
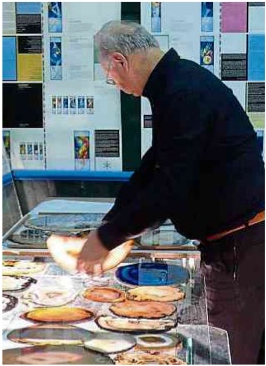
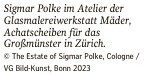
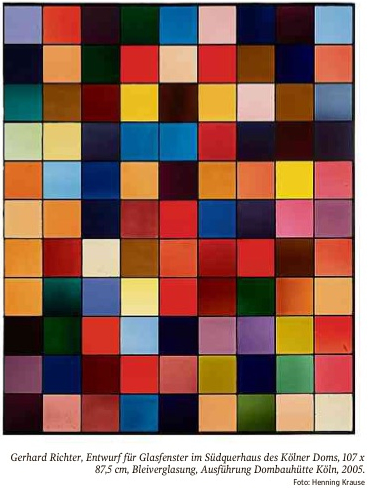
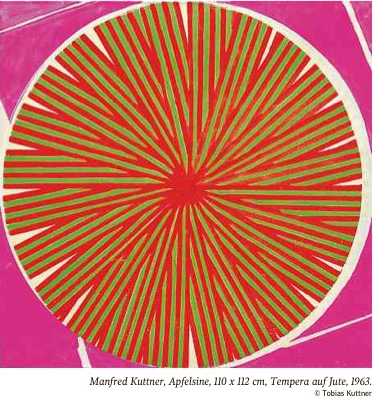
Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich, Rurstr. 9-11, 52441 Linnich, Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 11 bis I7 Uhr.
Eintritt 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Bis 7. Juli 2024.
Website: www.glasmalerei-museum.de

Kleine und große Meisterwerke auf Papier
Das Museum Folkwang in Essen zeigt ,,Made in Paris“ – Originalgrafiken, Künstlerbücher und Mappenwerke vom frühen 20. Jalirhundert bis in die die Gegenwart
Von Rotger Kindermann
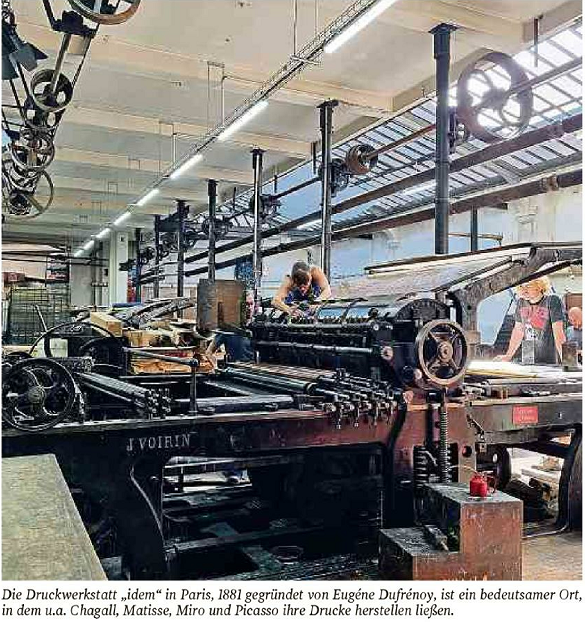
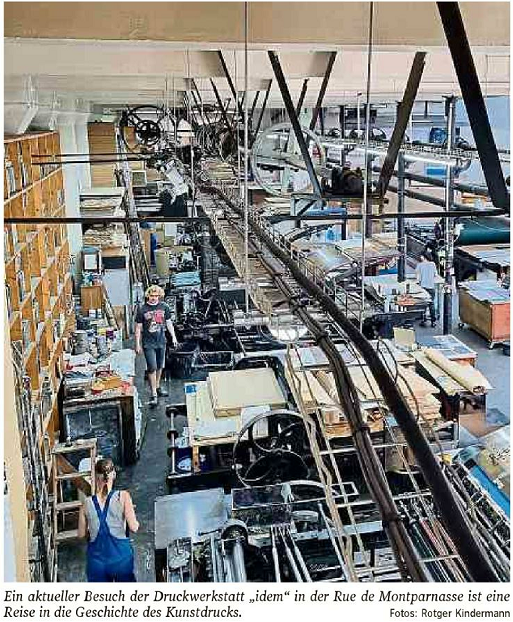
Es waren von Anfang an die französischen Impressionisten, die den Ruf des Folkwang Museums in Essen ausmachten. Für Kunstsammler und Museumsgründer Karl Emst Osthaus galten ihre Werke als ,,Synonym für Schönheit“. So gehört der konzentrierte Blick nach Frankreich zur Ausstellungschronologie des Essener Kunstmuseums. Die aktuelle Schau erzählt die Geschichte von Paris als Zentrum des Drucks von Plakaten, Kunstbüchem und Mappenwerken iiber einen Zeitraum von fast 130 Jahren. »Chagall, Matisse, Miró. Made in Paris“ präsentiert iiber 250 Meisterwerke auf Papier – von der kleinformatigen Druckgrafik bis zum großen Werbeplakat. Seit jeher verfügt das Folkwang über einen reichen Bestand an französischer Kunst, 80 Prozent der Drucke stammen aus der eigenen Sammlung, die meisten wurden zur Entstehungszeit erworben, doch bislang noch nie oder nur selten gezeigt. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte die Druckgrafik mit der Lithographie einen bemerkenswerten Aufschwung, zugleich entdeckten Pariser Künstler diese Technik fiir sich. „Man beschäftigt sich nur noch mit Druckgrafiken, es ist ein wildes Treiben, die Jungen machen nichts anderes mehr“, schrieb Camille Pissarro am 13. April 1897 an seinen Sohn Lucien, der gerade in London weilte. In diesem Jahr gründete sich eine „Société des peintres-lithographes“, die regelmäßig Ausstellungen organisierte, es etablierten sich feste Verkaufsstellen, in denen die aktuellen grafischen Blätter und Plakate angeboten wurden. Eine vielfältige Auswahl dieser plakativen Farblithographien ist in der Ausstellung zu sehen, darunter der Druck „Lä vitrine de Sagot“ von George Bottini, der eine Gruppe elegant geldeideter Damen vor einer bekannten Pariser Kunstbuchhandlung abbildet. Diese Kunstdrucke wurden zu internationalen Sammelobjekten und man darf mutmaßen, dass sie wesentlich zum Ruf der Pariserin als extravagante, mondäne Frau beigetragen haben.
Kein Plakat ohne Drucker
Zusammen mit der industriellen, mehr auf Konsum ausgerichteten Entwicklung gewann das Plakat als verkaufsförderndes Medium eine immer größere Bedeutung. Mit der neuen Technik konnten große Flächen mehrfarbig bedruckt werden. Bildmotive und Werbetexte wurden augenfällig zusammengefügt. Auch die Kunst- und Unterhaltungsszene wusste dieses Medium zu nutzen, wie die knallbunten Plakate der Varietébühnen „Moulin Rouge“ (1889) und „Folies-Bergère“ (1892) eindrucksvoll belegen. Die hohe technische Kunstfertigkeit von Druckereien ist dabei die wichtigste Voraussetzung, damit ein Plakatdruck gelingen kann. Der Beitrag „Kein Plakat ohne Drucker“ (Autor ist der Leiter des Deutschen Plakat Museums René Grohnert.) im Begleitkatalog zur Ausstellung beschreibt er detailliert, wie sich der Druckprozess von der Handpresse bis zur maschinellen Fertigung entwickelt hat. Und wie Drucker und Künstler sich gegenseitig herausforderten und inspirierten. Kontrast- und Farbqualität wurden kontinuierlich verbessert. Die meisten Künstler bevorzugten bestimmte Druckwerkstätten, mit denen sie zusammenarbeiteten. Pablo Picasso, der 1904 im Alter von 22 Jahren nach Paris zog, ließ bei Eugéne Delatre drucken, ein versierter Drucker, der zugleich ein begabter Grahker war. Die gezeigten Farbradierungen bezeugen die technische Meisterschaft der „Imprimerie Delatre et fils“. Auch Georges Braque und andere Kiinstler gehörten zu seinen Kunden. Über 25 Jahre hielt diese Kunst- und Geschäftsbeziehung bis sie aus Altersgründen beendet wurde und die Werkstatt von Roger Lacourière die Aufträge übemahm.Eine andere prägende Institution war später die Druckerei Mourlot Frères, wo neben Picasso auch Chagall, Matisse, Léger und Miro drucken ließen. Bei der Auswahl der Druckereien spielten die Verleger eine maßgebliche Rolle. Hier taucht von Beginn an der Name Ambroise Vollard auf, ein Kunsthändler, der das Potential lithographischer Plakate friih erkannte, und Kiinstler bat, Illustrationen anzufertigen, die sich gut verkaufen ließen. Sie schufen nicht nur Plakate, sondern auch Kunstbücher, die aus einzelnen Blättern bestanden. Man konnte sie einrahmen und im Wohnzimmer aufhängen.
Künstler profitierten
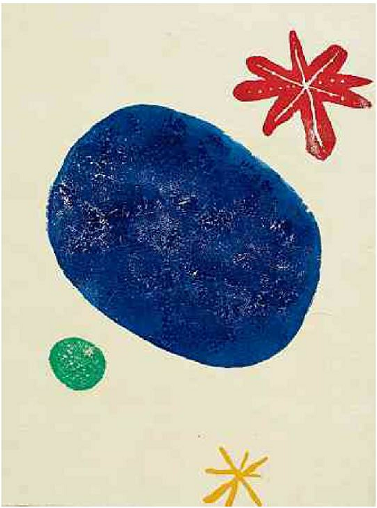
Joan Miro, Ohne Titel, 1958, Aus dem Portfolio Paul Eluard: A toute épreuve, Farbholzschnitt, 33 X 25,5 cm, © Successió Miró / VG Bild-Kunst, Bonn 2023.Foto: Museum Folkwang, Essen
Das präsentierte »Folies Bergére“-Plakat von Jules Chérets wurde für vier Franc angeboten, Toulouse-Lautrecs „Aristide Bruant dans son cabaret“, der Mann mit einem markanten roten Schal, im etwas größerem Format kostete sechs Franc. So wurde Kunst für breite Kreise erschwinglich. Auch die „Produzenten“ der Werke profitierten, denn das untemehmerische Risiko fir Herstellung und Vertrieb lag meist bei den Verlegern, so dass die Künstler unabhängig von der Zahl verkaufter Exemplare entlohnt wurden. „Künstler ersten Ranges betreiben das Entwerfen von Affichen als eine Spezialität, die ihnen Ruhm und fürstliche Einnahmen bringt,“ schrieb die Wiener Zeitung zur Jahrhundertwende. Die Beziehungen zwischen Vollard und „seinen“ Künstlern, die Erfolge und Misserfolge bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts werden in Wandtexten und im Ausstellungskatalog ausführlich beschrieben.
Auf neuen Wegen in die Gegenwart
Die von dem Kunsthistoriker Tobias Burg kuratierte Ausstellung bietet einen tiefen Einblick in das Zusammenwirken von Künstlern, Verlegern und Druckem in einer langen Phase des „wilden künstlerischen Treibens“, das zu Paris gehört wie Louvre oder Eiffelturm. Die Exponate sind auf zehn Räume verteilt, die bestimmten Gruppen von Kiinstlern zugeordnet werden. Chronologisch sortiert erzählen sie von den ständig neuen Wegen, die Kunst in Verbindung mit Technik einschlägt. Die dicht präsentierten Drucke werden aufgelockert durch ausgewählte Original-Gemälde, die die Verbindung zwischen Druckgralik und Malerei illustrieren.
Turbulentes Finale im Kino
Obwohl das Interesse an klassischen Kunstbüchern und Großplakaten in den 1970er Jahren deutlich abnahm, blieb die Pariser Drucktradition weiterhin lebendig. Besonders aus Amerika kamen neue Inspirationen. Diese Verbindungen werden exemplarisch dokumentiert von den beiden US-Universalkünstlern JimDine und David Lynch, die in den etablierten Pariser Werkstätten arbeiten ließen. So ist der letzte Raum, als kleines Kino eingerichtet, dem vielfach ausgezeichneten Filmregisseur Lynch gewidmet, der 2007 auf die Druckwerkstatt IDEM, ehemals bekannt unter dem Namen Mourlot Frères, aufmerksam wurde, und deren Arbeitsabläufe er in einem Kurzfilm vorstellt. In kontrastreichen Schwarzweiß-Szenen werden vier Facharbeiter beobachtet, wie sie Lynchs Lithographie „Murdered woman in burning car“ (2012) herstellen. Dröhnender Maschinenlärm begleitet dieses turbulente Finale und die Besucher erfahren: Auch im digitalen Zeitalter besteht Paris als Zentrum künstlerischer Druckproduktion fort.
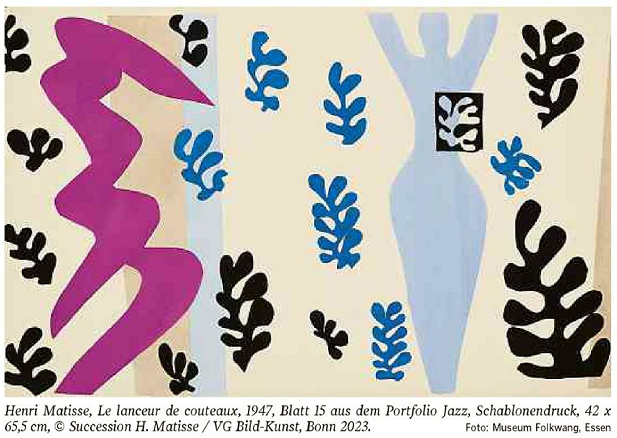
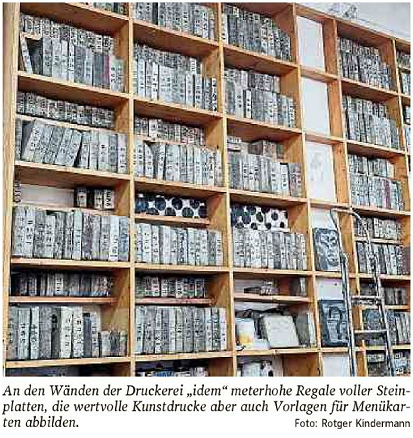
Chagall, Matisse, Mirö, Made in Paris“, bis 7. Januar 2024 im Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. Das Museum ist geöffhet dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. museum-folkwang.de. Katalog deutsch-englisch, 367 Seiten, 38 Euro.

Anna Boch – Eine Frau erobert die Kunstszene
Das Mu.ZEE in Ostende würdigt eine große Impressionistin
Von Rotger Kindermann
Frauen haben in der Kunst viele Jahrhunderte lang keine Rolle gespielt. Die Geschichte der Malerei war eine Geschichte der Männer, bis auf ganz wenige Ausnahmen – wie zum Beispiel die italienische Malerin Sofonisba Anguissola (1532-1625), eine Wegbereiterin der Renaissance. Frauen hatten fast keinen Anteil am Kunstgeschehen, sie dienten „nur“ als Motiv oder Inspirationsquelle. Das sollte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich ändern. 1867 wurde in Berlin ein ,,Verein der Künstlerinnen“ mit eigener Malschule gegründet, 1881 entstand in Paris die ,,Union der Malerinnen und Bildhauerinnen“. Dass Frauen zu den öffentlichen Kunstakademien nicht zugelassen wurden, musste auch die junge Belgierin Anna Boch (1848-1936) erfahren, der zum 175. Geburtstag das Mu.ZEE (Museum an der See) in Ostende eine eigene Ausstellung widmet.
Menschen bei der Arbeit
Die künstlerische Entwicklung dieser bemerkenswerten Impressionistin erfolgte in mehreren Etappen. Mangels anderer Möglichkeiten nahm die Industriellen-Tochter, die in einem privilegierten Umfeld aufwuchs, an privaten Malkursen für Frauen teil, wo sich bald ihr Talent offenbarte. Vermutlich hat die Fayencemalerei ihr Kunstinteresse geweckt, denn ihr Vater Victor Boch gründete zusammen mit seinem Bruder Eugène 1841 die bis heute bekannte Porzellanmanufaktur (Boch Fréres) im ostbelgischen La Louvière, in deren Ateliers sich die junge Anna inspirieren ließ. Im Alter von 26 Jahren nimmt sie Malunterricht bei dem Antwerpener Künstler Isidoro Verheyden, später Direktor der Brüsseler Kunstakademie, mit dem sich eine lange und intensive Zusammenarbeit aufbaut.
Die beiden malen gemeinsam Stillleben, portraitieren sich gegenseitig, reisen an die belgisch-niederländische Küste, deren unberührte Landschaft Boch besonders fasziniert. Bäuerliche Szenen aus dieser Region, in der sie später einen Landsitz erwirbt, dominieren ihr Gesamtwerk Boch malt Menschen bei der Arbeit, einfache Bauernhäuser von Blumen umgeben, farbenreiche, lebendige Szenen.
Eine ,,männliche Begabung“?
Das Mu.ZEE zeigt eine ganze Reihe dieser ab 1883 entstandenen Landschaftsbilder – wie die „Rückkehr von der Messe durch die Dünen“, „Dorf in den Dünen“ oder die „Rückkehr vom Fischfang“ – mit denen Boch damals sogar die Pariser Kunstkritik überzeugte. Die Arbeiten werden wegen ihrer Farbharmonie und feinen Farbabstufung gerühmt, die Presse glaubt gar in Boch’s Malerei „eine männliche Begabung“ zu erkennen, ein Kommentar, den die Künstlerin schlicht ignoriert. Unbeirrt setzt sie ihren Weg fort, der sie in Richtung Pointillismus führt. Womit sie sich von ihrem Förderer Verheyden abwendet und Anschluss an die neue Bewegung „Cercle des Vingt“ (kurz: Les XX) sucht.
Boch entwickelt nun einen intuitiven, kommaförmigen Pinselstrich, der ihrer Malerei mehr Leuchtkraft verleiht. Im Februar 1895 gelingt Anna Boch ein künstlerischer Durchbruch als sie das Bild „Im Juni“ ausstellt, auf dem eine junge Frau im weißen Kleid mit Sonnenschirm vor violetten Clematis-Bliiten zu schen ist. Erstmals kauft der belgische Staat eines ihrer Gemälde.
Leidenschaft für Reisen
Die Boch-Ausstellung im Mu.ZEE zeigt nicht nur Bilder, Zeichnungen, Porzellanmalereien, Schriftstücke und Reisefotos dieser äußerst vielseitigen Künstlerin. Besucher’innen werden Zeugen eines Lebens, dass ständig von neuen Begegnungen, Erfahrungen und Erlebnissen geprägt ist Und das wird sowohl mit dem Malpinsel, als in späteren Jahren auch mit dem Fotoapparat festgehalten. Reisen war eine besondere Leidenschaft, wie ihr an den Museumswänden großflächig dokumentierter Lebenslauf beschreibt.
Seit ihrer Jugend malen Anna und ihr Bruder Eugène gemeinsam auf zahlreichen Reisen, die sie u.a. nach Italien, Spanien und Marokko führen. „Nur durch Reisen lernt man wirklich etwas,“ schreibt sie an eine Freundin. 1901 entdecken die beiden Geschwister die Bretagne. Dort beeindrucken Boch die schroffen Felsformationen, vom tosenden Meer umgeben, und diese Szenen werden von ihr immer häufiger bildnerisch festgehalten. Einige dieser kontrastreichen Bretagne-Bilder zeigt das Museum aus einer privaten Kollektion.
„Mademoiselle Boch hat sich längst einen prominenten Platz unter den Landschaftsmalern erobert“, urteilt 1912 ein Kunstexperte in einer englischen Fachzeitschrift. Das sind die Motive, die Boch auch in ihrem Spätwerk gerne aufgreift, wie u.a. das ausgestellte Gemälde „Cliff von Sanary“ aus dem Jahr 1924 belegt. Gegen Ende ihres langen Lebens malt sie wieder bevorzugt Blumendekors oder Stillleben, und kehrt dabei zurück zu Kompositionen mit breiter, großzügiger Pinselführung.
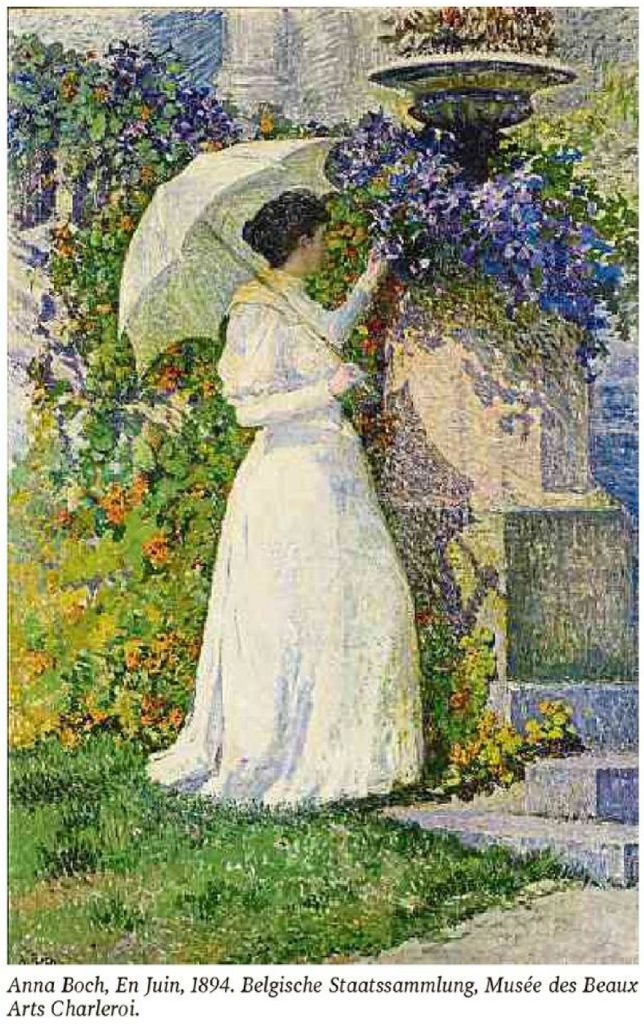
Emanzipiert und zum Protest bereit
Dieser erneute Stilwechsel beginnt bereits 1904, als sich Boch der Gruppe „Vie et Lumière“ anschließt. Diese, auch als „belgische Luministen“ bezeichnete Künstlervereinigung, wollte ihre Werke ohne Zulassungsanforderungen von Juroren ausstellen. Überhaupt ist der Protest ein fester Bestandteil im Leben dieser fortschrittlichen, emanzipierten Frau, was sich jedoch nicht in ihren farbefrohen, harmonischen Motiven bemerkbar macht. So tritt Boch 1882 in die „Belgische Liga für Frauenrechte“ ein. 1927 beklagt sie, dass ein Pariser Kunstsalon die Malerinnen nicht ehrt“. Sie brauchte kein Blatt vor den Mund zu nehmen, die finanzielle Unabhängigkeit gestattet ihr ein unabhängiges sorgenfreies Leben, in dem neben der Malerei auch die Musik eine wichtige Rolle spielt. Sie ist eine virtuose Pianistin und singt selbst auf ihren Privatkonzerten. Boch’s Haus im Brüsseler Stadtteil Ixelles (leider 1954 abgerissen) beherbergte einen 60 qm großen Musiksaal, in dem der französische Komponist Claude Debussy regelmäßig gastierte. Mit Hilfe von historischen Fotos und anderen Dokumenten ist es dem Mu.ZEE gelungen, die gesamte Bandbreite dieser Künstlerin aufzuzeigen und sie einem breiten Publikum in Erinnerung zu rufen.
Ein anderes Museum
Zur Konzeption des Mu.ZEE gehört es von Beginn an, mit Ausstellungen den ganzen Menschen zu zeigen, nicht nur den Künstler. Damit sollen alle Gesellschaftsschichten als Besucher gewonnen werden, auch solche, die sonst von Kunst kaum Notiz nehmen. Überhaupt beansprucht dieses Museum eine gewisse Sonderrolle, die sich schon in seinem Äußeren dokumentiert. Weder in einem monumentalen Prunkbau des Klassizismus noch in einem von Stararchitekten aufwendig erbauten Designtempel ist die Kunst-Heimstätte von Ostende untergebracht. Sie wird – höchst ungewöhnlich – in einem ehemaligen Kaufhaus beherbergt, das für seine besonders große Stoffabteilung bekannt war. „Stoffenverkoop“ lautet die Überschrift einer vor ca.70 Jahren entstandenen Wandzeichnung im Eingangsbereich.

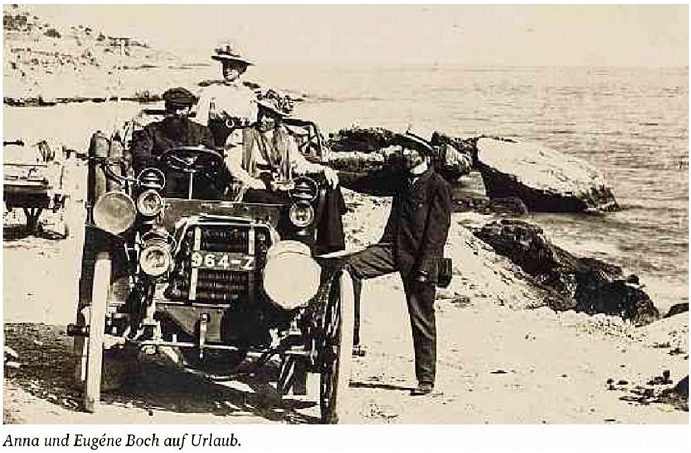
Eine durchaus mutige Entscheidung, die die Stadtverwaltung damals nach der Zwangsschließung des Warenhauses traf So wenig spektakulär können Museen daherkommen, wenn die Inhalte ihrer Ausstellungen überzeugen.
„Anna Bloch, an impressionnist joumey“, Romestraat 11, 8400 Oostende, dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr, montags geschlossen. Tickets 15 Euro, Jugendliche bis 26 Jahre drä Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei. Die Ausstellung zeigt 96 Arbeiten von Anna Boch, dazu einige von Ensor, Gauguin, Signac und Van Gogh; sie läuft bis zum bis 11. November 2023. www.muzee.be

Wo alles glänzt und glitzert
Das Diamantenmuseum in Antwerpen DIVA erstrahlt in neuem Licht
Von Rotger Kindermann
Eulenbecher aus der Sammlung König-Baudouin-Stiftung Fonds für das Kulturerbe.
Die größten und wertvollsten Diamanten der Welt tragen schillernde Namen. Sie heißen Cullinan, Hope, Koh-i-Noor oder Pink Star und beeindrucken durch Glanz und Reinheit. Viele dieser legendären Edelsteine befinden sich seit jeher in den Händen von Königshäusern. Der Koh-i-Noor (Berg des Lichts) gehört beispielsweise zu den britischen Kronjuwelen und kann im London Tower besichtigt werden. Nicht allein die Damen des Adels, auch Schauspielerinnen glitzernden Schmuckstücke. Die Juwelen der gefeierten Diva wurden 27 Jahre nach ihrem Tod für 1,4 Millionen Euro versteigert. Ob die „göttliche“ Primadonna bei der Namensgebung des Antwerpener Diamanten-Museums Pate gestanden hat? Jedenfalls passt der Name „DIVA“ perfekt zu dem extravaganten Thema, dem sich die Ausstellung widmet. Ohne Frage assoziiert er ein Umfeld voller Luxus und Glamour.
Lange Renovierungsphase hat gutgetan
Seit 575 Jahren sind Antwerpen und Diamanten fest miteinander verbunden. Damals ließen sich die ersten Diamantenschleifer nieder, der Import erfolgte direkt über die Hafenstadt an der Schelde. Der gängige „Brillantschliff mit seinen 57 Facetten wurde hier erfunden. Heute werden mehr als 80 Prozent aller Rohdiamanten weltweit in Antwerpen gehandelt, laut Branchenverband „Antwerp World Diamond Center“ reden wir über einen Umfang von ca. 35 Mio. Karat* jährlich. Dass in dieser Stadt der Juweliere, Diamantenhändler und Schleifer ein Museum die „Diamanten-Story“ erzählt, versteht sich fast von selbst.
Erst seit wenigen Wochen – nach einer jahrelangen Renovierungsphase – hat das DIVA-Museum wieder geöffnet. Innen wurde dem Haus ein neuer Look mit raffinierten Lichteffekten verpasst, der den kostbaren Schmuckstücken noch mehr Ausstrahlung verleiht. Der Einstieg in die Welt der Diamanten startet – didaktisch sinnvoll – mit den Fundorten und den verschiedenen Arten der Gewinnung. Landkarten, Tabellen, Fotos von Minen und großformatige Wandtexte erklären dem Besucher, wo und wie die „Schatzsuche“ ihren Anfang nimmt. Wer ausführlichere Informationen wünscht, kann dazu mehrsprachige Audioguides nutzen.
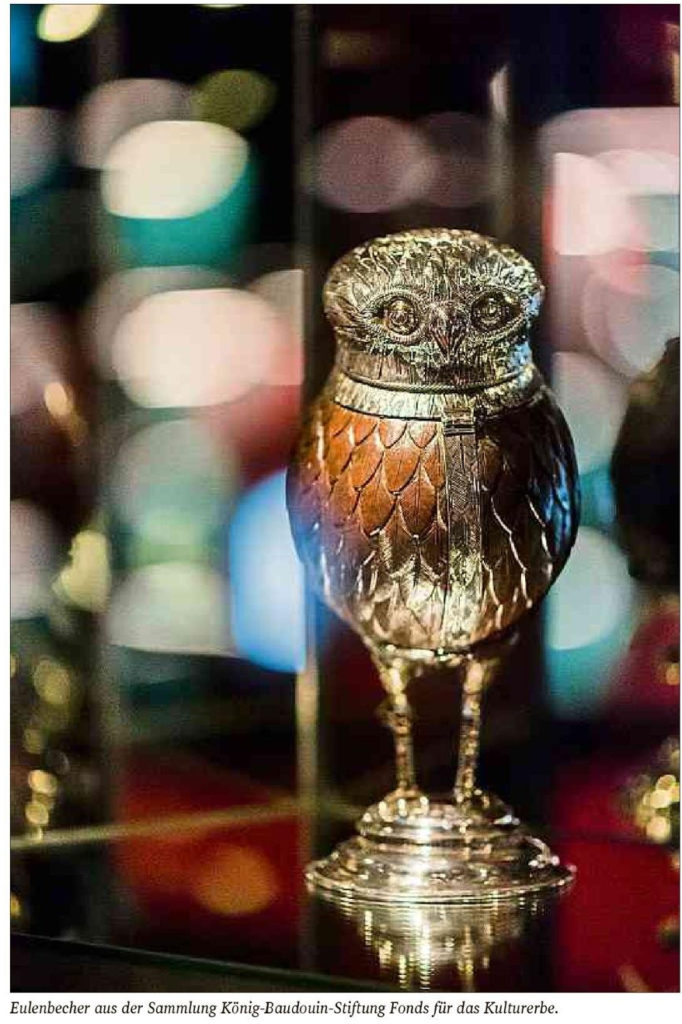
Luxuswelt mit Schattenseiten
Von Beginn an wird deutlich, dass die funkelnde Luxuswelt auch ihre Schattenseiten hat. Denn die vier wichtigsten Abbau-Länder sind Botswana, Kongo, Südafrika und Russland, das mit jährlich 17 Mio. Karat den Spitzenplatz belegt. Jeder vierte Diamant auf der Welt stammt aus Putins Reich. Das kann nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine niemand ignorieren. Dass Steine mit diesem Ursprung bisher nicht auf der EU-Sanktionsliste gelandet sind, verwundert, aber Belgien hat sich bislang dagegengestemmt. Dessen ungeachtet sind die russischen Diamanten-Exporte erheblich gesunken, weil die USA als größter Absatzmarkt schon vor Monaten einen Boykott verhängt haben. Inzwischen scheint Belgien bereit, sich dem Druck zu beugen. Immerhin thematisiert das „DIVA“ die Probleme mit den sog. „Blutdiamanten“ aus Konfliktregionen, die genutzt werden, um Stammeskämpfe und andere Kriege zu finanzieren. Gerade deshalb sollen die internationalen Bemühungen, die Herkunftszertifikate für Rohdiamanten zu verbessern, fortgesetzt werden.
Kunstgeschmack der Jahrhunderte
In den Vitrinen des „DIVA“ kommt nicht nur die Diamantenpracht zur Geltung, auch Gold-und Silberexponate für mancherlei Verwendung werden gezeigt. Zu den meisterhaften Preziosen gehören üppig verzierte Monstranzen, Altarschmuck und liturgische Gefäße, die von großer mittelalterlicher Handwerkskunst zeugen. Passend dazu werden alte und neue Werkzeuge der Diamantenschleifer, Gold- und Silberschmiede präsentiert, oft winzige Instrumente, deren Handhabung auf den ersten Blick rätselhaft erscheint.
Die gezeigten Objekte dokumentieren den Kunstgeschmack vergangener Jahrhunderte: Von der langen Halskette mit 25 in Gold gefassten Bergkristallen, die Isabella Brandt, die erste Ehefrau des Antwerpener Barockmalers Peter Paul Rubens (1577-1640), getragen hat bis zum diamantenbesetzten Tennisschläger, der Ivan Lendl gehörte und den er dem DIVA vermacht hat. Dabei ist das „DIVA“ nicht nur Showroom, es bietet mit seinem Atelier auch eine Verbindung zwischen Museum und Praxis. Hier finden Meisterkurse und Workshops statt, die z.B. die kreative Seite der Goldschmiedekunst neu beleuchten. Wer sein eigenes Wissen über Gold, Silber und Edelsteine vertiefen möchte, hat dazu in einer eigenen Fachbibliothek die Chance.
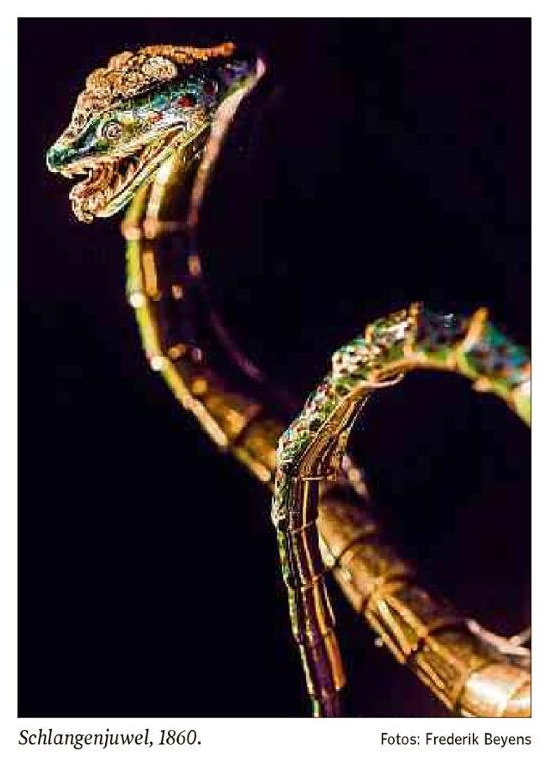
Wie in einem Schloss
Besonders faszinierend ist der Wechsel zwischen moderner und klassischer Raumgestaltung. Dabei führt der Rundgang (insges. über drei Etagen) in einen mit riesigen Kronleuchtern ausgestatteten Festsaal, der Museumsbesucher glaubt in einem Schloss zu sein. Reich dekorierte Tische präsentieren ein Rausch von Silber-Kostbarkeiten, hochwertige Bestecke, fein ziselierte Obstschalen, mehrarmige Kerzenleuchter oder elegant modellierte Vasen lassen die Blicke schwelgen. Durch eine ausgeklügelte Lichtarchitektur, die hell-dunkel variiert, fügen sich die matt glänzenden Zierstücke zu einer prunkvollen Gesamtkreation zusammen.
Wer möchte, kann die erhabene Schloss-Atmosphäre noch akustisch untermalen. Der letzte Raum macht dem Namen des Museums alle Ehre. Im Boudoir, dem Ankleidezimmer einer Diva, kann man am Bildschirm digital testen, welcher Schmuck zu einem passt, welche Halsketten, Broschen oder Haarspangen einem noch mehr Schönheit verleihen. Wie sang doch Marylin Monroe in dem bekannten Broadway-Musical: ,,Diamonds are a girl’s best friend“. Das wird wohl immer so bleiben.
*In Karat wird das Gewicht von Diamanten angegeben, ein Karat entspricht 0,20 Gramm.
Museumsstadt Antwerpen Die flämische Hafenmetropole verfügt über einige sehenswerte Museen. Hier eine Auswahl: Rubenshaus, Wapper 9-11, ehemalige Wohnung und Werkstatt des Malers; Königliches Museum für Schöne Künste, Leopold de Waelplaats 1, Schatzkammer der flämischen Kunst; MAS - Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, Schifffahrt, Völkerkunde, variable Themen; Red Star Line Museum, Montevideostraat 3, Geschichte der Auswanderer.

Figur und Natur im Einklang
Skulpturenpark Waldfrieden im Wuppertaler Stadtteil Barmen zeigt figürliche Meisterwerke des Von der Heydt-Museums
Von Rotger Kindermann
Eine gute Figur machen“ kennen wir als Redewendung im Alltag -gleichbedeutend mit der Feststellung „einen guten Eindruck machen“. Sie bedeutet, dass jemand durch Aussehen, Auftreten oder Kleidung positiv auf andere wirkt. Ihre „gute Figur“ zeigen nun ausgewählte Meisterwerke aus der Skulpturensammlung des Wuppertaler Von der Heydt-Museums, von denen viele erstmals außerhalb der Museumsmauern präsentiert werden. Ort der Ausstellung „FIGUR!“ ist der Skulpturenpark Waldfrieden im Stadtteil Barmen, eine Art Freilichtmuseum inmitten der Natur.
Die von Bildhauer Tony Cragg und Museumsdirektor Roland Mönig kuratierte Schau konzentriert sich auf Darstellungen der menschlichen Figur, die zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und den 1980er Jahren geschaffen wurden. Unter mächtigen Baumwipfeln blicken die Besucher auf über hundert Jahre künstlerischer Emanzipation, sie erkennen, wie die Werke sich allmählich von der naturalistischen Darstellung entfernen, wie sich ein „Prozess der ästhetischen Befreiung“ vollzieht. Wie unterschiedlich die Sichtweisen auf den menschlichen Körper sein können, wie sehr die Formensprache bei der Gestaltung einer Figur divergiert, zeigen u.a. die Arbeiten von Auguste Radin, Edgar Degas, Hans Arp oder Käthe Kollwitz.
Tony Cragg und der Skulpturenpark
Tony Cragg, geboren 1949 in Liverpool (Kunststudium am Royal Collage of Art in London; 1976 Lehrauftrag an der Kunsthochschule Metz; 1979 Wechsel zur Kunstakademie Düsseldorf; 1988 Professor für Bildhauerei; 2009 bis 2013 Rektor der Kunstakademie Düsseldorf) ist seil dem Brexit deutscher Staatsbürger.
Seine Werke wurden ausgestellt auf documenta, Biennale Venedig etc. Skulpturen im Außenbereich stehen u.a. in Berlin, Bonn, Wuppertal. Remscheid, Viersen.
Das Areal des Skulpturenparks war ursprünglich ein Privatgrundstück des Lackfabrikanten und Kunstsammlers Dr. Kurt Herberts. Er beschäftigte während der Nazi-Zeit Künstler, die damals „Mal-Verbot“ hatten. 1947 ließ er die Villa „Haus Waldfrieden“ erbauen. Nach Herberts Tod 1988 und dem Verkauf seiner Firma waren Park und Villa dem Verfall preisgegeben. Bis Tony Cragg das herrenlose Hanggelände 2006 entdeckte, erwarb und es in einen Skulpturenpark, der heute als Privatmuseum von der Cragg- Foundation betrieben wird, verwandelte. rk
Bildhauer Tony Cragg:
Der Wald ist für die Kunst da und die Kunst für den Wald. Keiner von beiden übertrumpft den anderen.
Erkundung mit dem eigenen Körper
Ihr habt in Waldfrieden etwas gemacht, was gar nicht so einfach ist. Ihr habt ein Gefühl für die realen Qualitäten von Skulptur geschaffen:
Durch den Kontakt mit der Natur, durch den Kontakt mit dem Waldgrundstück, das von Wegen durchzogen ist und dann auch durch die Ausstellungsorte. Das gilt nicht nur für die im Freien aufgestellten Werke, sondern auch für die Ausstellungspavillons, die selbst schon eine skulpturale Qualität aufweisen,“ sagt Roland Mönig im Gespräch mit Tony Cragg (veröffentlicht im Katalog zur Ausstellung, Seite 47 ff.), ein inspirierender Dialog, der zum besseren Verständnis der ausgestellten Werke beiträgt. Denn hier wird der Unterschied zwischen der Kunstform „Skulptur“ und anderen materiellen Kunstformen anschaulich thematisiert. Kunst brauche „Betrachterinnen und Betrachter … , vor allem dann, wenn es um figurative Arbeiten geht“. Dabei entstehe eine bestimmte Spannung, betont Cragg. Er möchte nicht behaupten, dass Menschen sich in den Skulpturen gespiegelt sehen, aber „auf jeden Fall gibt es einen Wiedererkennungs-Moment in der Form.“ Am Ende würden die Besucher in einer figürlichen Skulptur sich selbst erblicken . „Sie treffen auf einen Körper, zu dem sie sich in Relation setzen müssen.“

Gewiss, auch Gemälde oder Zeichnungen haben eine körperliche und materielle Anmutung. Die ist aber nach Meinung von Roland Mönig in der Skulptur am deutlichsten, „weil man der Skulptur eins zu eins körperlich begegnen muss“. Ein Bild habe immer nur eine Ansicht, eine Skulptur aber umkreist man, erkundet sie mit dem eigenen Körper.
Beeinflusst vom Licht
Aus den rund 500 Werken, über die die Von der Heydt-Sammlung verfügt, haben Cragg und Mönig gerade mal 45 für den Skulpturen park ausgewählt, trotzdem ist das Spektrum dieser Auswahl enorm. Vertreten sind klassische „Figuren“, wie die von Max Klinger (Badendes Mädchen) und ebenso Künstler, die den Körper konsequent als Abstraktion darstellen, wie Hans Arp (Daphne) oder Lynn Chadwick (Zwei Wächter), eine Komposition aus geschweißtem Draht und Zement. Die meisten Werke sind in den beiden Glaspavillons ausgestellt, ganz im Sinne von Tony Cragg, der hier „ein neues Licht auf die Skulpturen werfen“ will. In einem Museumsgebäude mit funktionalen Räumen und meist kleinen Fenstern sei das kaum möglich. So bevorzugt er auch für seine eigenen Arbeiten. Standorte im Freien, dort, wo die Wechselspiele des Lichts formen und Farbe einer Skulptur beeinflussen. Natürlich dominieren in der 14 Hektar großen Parkanlage Cragg- Werke – aber auch Arbeiten von Markus Lüpertz, Joan Mir6, Henry Moore, Thomas Schütte und anderen haben hier einen einzigartigen Platz.
Cragg: Der Wald ist für die Kunst da …
Der aus Liverpool stammende Bildhauer Tony Cragg hat vor 17 Jahren den völlig verwilderten Waldpark (samt Villa Waldfrieden) erworben und ist seitdem zum Landschaftspfleger geworden. Besucher erleben ein eindrucksvolles Zusammenspiel von Kunst und Natur, von Licht und Schatten, von Lichtung und Wald. Immer wieder tauchen ganze Figurengruppen auf, wie die Skulpturen „Declination“, „Conversation“, und „Points of View“, die Cragg auf einem Plateau zwischen den beiden Pavillons errichten ließ. In dieser Verdichtung wird Craggs ypische Formensprache besonders augenfällig, diese dynamischen Drehungen, dieses Schichten und Stapeln – und dieses rotierende „Quetschen“ seiner Skulpturen, wie er es nennt. Sie sind Ausdruck einer spannungsvollen Harmonie, die Cragg auf den gesamten Skulpturenpark übertragen möchte: „Naturschutz, Denkmalschutz und Landschaftsschutz. Der Wald ist für die Kunst da und die Kunst für den Wald. Keiner von beiden übertrumpft den anderen.“
Museumsdirektor und Kurator Roland Mönig: Ein Bild hat immer %nur eine Ansicht, eine Skulptur aber umkreist man erkundet sie mit dem eigenen Körper.
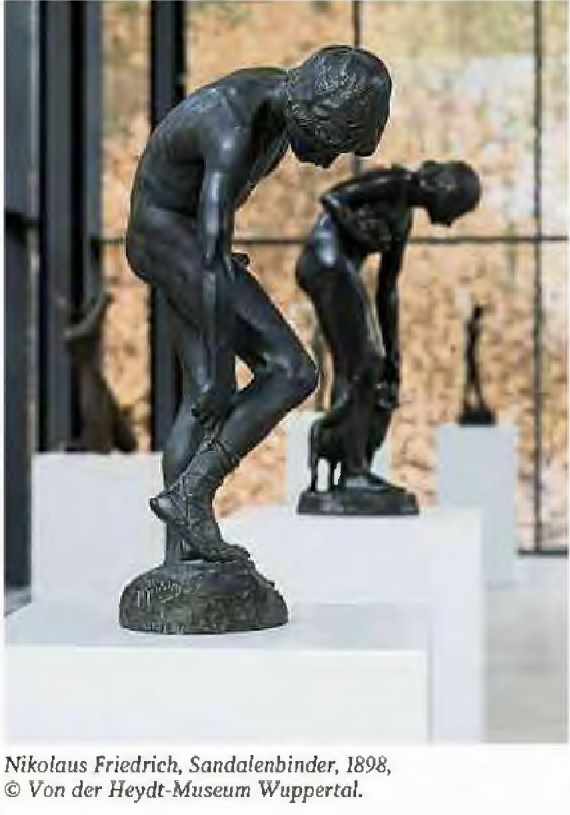
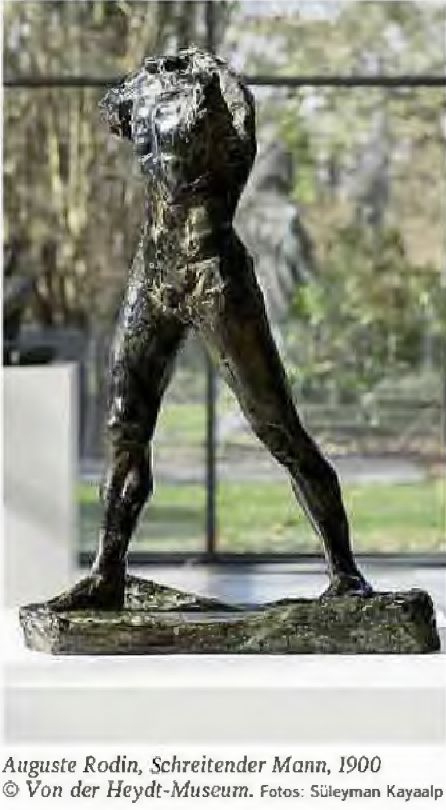

„Figur!“, noch bis zum 20. August im Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, 42285 Wuppertal, dienstags bis sonntags von ll bis 18 Uhr. Tickets: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Katalog 29 Euro. www.skulpturenpark-waldfrieden.de

Wo Pflanzen mehr als nur Bilder sind
Die Ausstellung „Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ führt zurück ins frühe 20. Jahrhundert und fragt nach der Darstellung der Pflanze in der Bildenden Kunst, ihrer Betrachtung in der Botanik und Gesellschaft allgemein
Von Rotger Kindermann
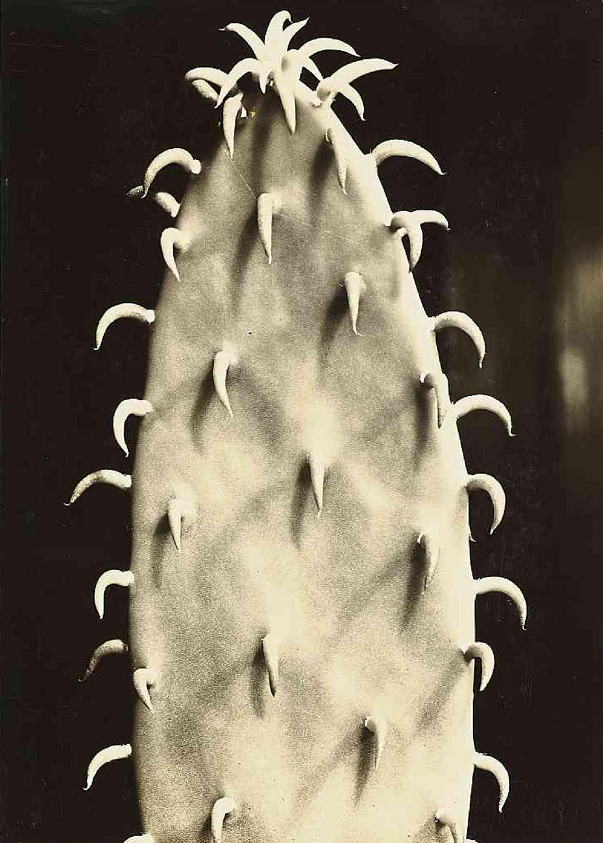
Die Pflanze als das Andere. Topfpflanzen erzählen auch von Widersprüchen, Ängsten, Sehnsüchten und Ideologien der Moderne
Die Wahrscheinlichkeit, dass Bilder dieser Ausstellung von Öko-Aktivisten der „Letzten Generation“ mit Kartoffelpüree beworfen werden, ist eher gering. Auch in der Protestbewegung wird sich herumgesprochen haben, dass das Kölner Museum Ludwig unter dem Titel „Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ ein Konzept mit großer Nachhaltigkeit verfolgt. Kontrastreiche expressionistische Landschaftsbilder sollte hier niemand erwarten, das Museum spürt eher der Faszination für Zimmerpflanzen in Kunst und Gesellschaft nach. Vielversprechend wird im Eingangsbereich (über einer Malwand für Kinder) eine „Rankhilfe für grüne Visionen“ angekündigt. Mit Blick auf die ökologisch-nachhaltige Ausstellungsarchitektur trifft das zu, ob allerdings Auswahl und Kunst-Präsentierungen auch inhaltlich-substanziell diesem Attribut gerecht werden, mag jeder Besucher für sich entscheiden.
Experiment für mehr Nachhaltigkeit
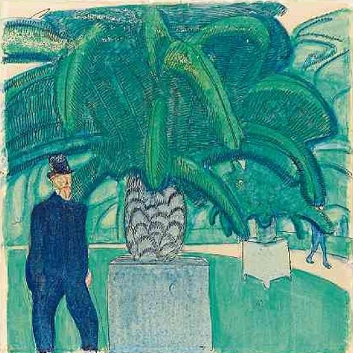
Otto Feldmann, Park mit Palme und Herr in Blau, 1911/1913, Museum Ludwig, Köln.
Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln/Sabrina Walz
Für Museumsdirektor Yilmaz Dziewior ist es eine Art Testausstellung, in der man Erfahrungen sammelt, „wie wir in Zukunft Ausstellungen nachhaltiger konzipieren und realisieren können.“ Am praktischen Beispiel der von Hand gepinselten Wandtexte macht Kuratorin Miriam Szwast das deutlich: „Wir verzichten auf Plastikbuchstaben und Folien, die wir sonst immer hatten, die vielleicht toll aussehen, aber natürlich nicht recycelbar sind. Hier kann man später drüberstreichen.“ Auch in anderen Bereichen wurde Neuland betreten: Auf CO2 freisetzende Kunsttransporte hat man bewusst verzichtet, fast alle Exponate stammen aus dem eigenen Depot und es werden mehr Reproduktionen gezeigt. Das Museumsgebäude wurde komplett auf Ökostrom aus Wasserkraft umgestellt, die Exponate werden mit energiesparendem LED-Licht beleuchtet. Und der Ausstellungskatalog ist ressourcenschonend nur online erhältlich. Auf der Dachterrasse des Museums dienen ausgediente Transportkisten als Hochbeete; darin werden Kräuter gezogen, die später im Museumsrestaurant Verwendung finden. Im Rahmenprogramm werden Klima-Workshops angeboten. Schlussendlich fließt von jedem verkauften Ticket ein Euro in Naturschutzprojekte.
Der Kaktus – eine gezähmte Wildnis
Beim gründlichen Blick in die eigene Fundgrube haben die Kuratoren einiges aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts entdeckt, dass die Ausstellung – auch ohne Leihgaben – sehenswert macht. Da ist zum Beispiel die künstlerische Betrachtung des Kaktus, der sich seinerzeit einer besonderen Beliebtheit erfreuen konnte. Unter dem Einfluss der Kolonialzeit erwachte ein breites Interesse für exotische Pflanzen – Kakteen, Agaven, Gummibäume standen in den bürgerlichen Wohnzimmern. Es war eine Art gezähmte Wildnis, die auf Fensterbänken und in Blumentöpfen ihren Platz fand. Naturnahe Zimmergärten waren „en vogue“. So findet man den Kaktus in der Fotografie, in der Stillebenmalerei der Neuen Sachlichkeit oder als Dekorationspflanze in der Bauhaus-Architektur. Davon zeugen mehrere Bilder u.a. von Otto Dix genauso wie die vergrößerte Postkarte vom tropischen Ballsaal der Kölner Flora aus dem Jahr 1928. Die Gäste speisten und tanzten hier unter Palmen und anderen Urwaldpflanzen.
Blumen als Symbol der Weiblichkeit
Insgesamt 130 Exponate in vier Kapiteln erzählen kurzweilig und vielseitig vom grünen Aufbruch in eine neue Zeit. Flora, die antike Göttin der Blüte, lebte auch in der modernen Frau fort, die Bubikopf trug, im Hosenanzug posierte – und so einen Trend zur „Geschlechter-Unordnung“ dokumentierte. Das bekannte Porträt von Marlene Dietrich unterstreicht diesen Zwiespalt und sie begegnet ihm mit einer übergroßen Blüte am Revers ihres Fracks und einem ironischen Lächeln. Andererseits waren es die Frauen, die sich – trotz aller Bekenntnisse zur Emanzipation – um Pflanzen kümmerten. Dies belegen zahlreiche Fotos, die sie in zärtlicher Umarmung eines Blumentopfes abbilden. Und wie sehr unsere Vorstellung von Weiblichkeit mit Blumen verknüpft ist, zeigen Frauenfotos, auf denen sie alle Kleider mit Blumenmuster tragen. Im Gegensatz dazu trat ab 1911 der Tänzer Vaslav Nijinsky weltweit im Ballett „Le Spectre de la rose“ als „Verkörperung belebenden und verführerischen Blumenduftes“ auf, wie es eine Zeitung schrieb. In seiner Rolle als Rose mit einem Kostüm voller rosafarbener Seidenblüten wollte er zur Befreiung überlieferter Geschlechterrollen beitragen. Die Ausstellung spiegelt die vielfachen Formen von Sexualisierung der Blumen wider und macht sichtbar, wie verschiedenartig das Verhältnis des Menschen zu ihnen sein kann.

Karl Schmidt-Rottluff, Rittersporn am Fenster, 1922, Museum Ludwig, Köln © VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln/Sabrina Walz
Spektakulärer Zeitraffer-Film
Nach Betrachtung einer Überfülle von dicht an dicht präsentierten Fotografien, Grafiken und Drucken, die in Teilen etwas improvisiert wirkt, werden die Besucher belohnt mit einem sehenswerten Zeugnis aus den frühen Jahren des Stummfilms. Die Kinos waren voll, als 1926 der Film „Das Blumenwunder“ die Welt der Pflanzen ganz neu vor Augen führte. Er zeigt verschiedene Blumen und Gewächse unter dem Mikroskop und in spektakulären Zeitraffer-Aufnahmen. Dass eine Pflanze lebt, sich bewegt, quasi einen Puls habe und sogar ermüden könne, beschrieb damals das populäre Buch „Die Pflanzenschrift“. Und der Film trat den sichtbaren und beweglichen Beweis an, die Zuschauer waren begeistert. Es war die Zeit, als sich die Erkenntnis verbreitete, dass die Pflanze den Sauerstoff produziert, den der Mensch atmet. Die Menschheit begriff, dass sie von Pflanzen abhängig war, man erkannte sie als wertvolles Lebewesen. So dokumentiert der Film im Zeitraffer-Tempo das Wachstum von Astern, Gladiolen, Maiglöckchen, Rosen und Strelitzien – immer wieder unterbrochen von Tanzszenen eines Balletts, das sich simultan zur Pflanzenschwingung bewegt. Manche Blüten tragen gesichtsähnliche Züge. Die Grenze zwischen Menschen und Pflanzen verschwimmt in diesem Film-Kunstwerk.
Schon früher gab es Sehnsucht nach Natur
So nüchtern manche Topfpflanzen aussehen mögen, sie sind immer auch ein Symbol für unsere Sehnsüchte und unserem Wunsch nach Natur und Anmut. Das mag auch Antrieb für Ferdinand Franz Wallraf, dem bekannten Kölner Gelehrten und Museumsstifter, gewesen sein, als er 1784 – nur einen Steinwurf vom heutigen Museum Ludwig entfernt – den ersten Botanischen Garten Kölns1 errichten ließ. Auf einem Grundstück nördlich des damals noch unvollendeten Dombaus entstanden Gewächshäuser, über 2 500 neue Pflanzen wurden angeschafft, heißt es in einer Stadtchronik. Womit letzten Endes geklärt ist, dass die Sicht auf Pflanzen schon in früheren Zeiten „modern“ war und dem Ausstellungsort in Köln diesbezüglich eine gewisse Vorreiterrolle zukommt.
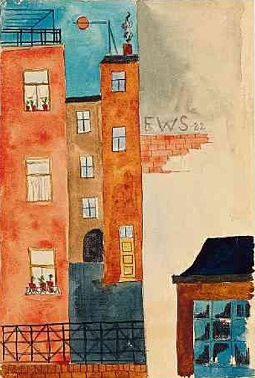
Franz Wilhelm Seiwert, Hinterhof, 1922, Museum Ludwig, Köln
Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln
Wir verzichten auf Plastikbuchstaben und Folien, die wir sonst immer hatten, die vielleicht toll aussehen, aber natürlich nicht recycelbar sind. Hier kann man später drüberstreichen.
Kuratorin Miriam Szwast
1 Zu sehen auf einem Stahlstich um 1820 „Botanischer Garten und Dom.“
„Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ noch bis 22. Januar im Museum Ludwig in Köln, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln, direkt am Hauptbahnhof, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, www-museum-ludwig.de.

Gratwanderung zwischen Abstraktion und Realität
Belgiens Königliches Kunstmuseum deutet Pablo Picasso
Von Rotger Kindermann
Picasso war nicht nur einer der größten, sondern auch der fleißigsten Maler, die es je gab. Über 15 000 Werke sind von ihm bekannt. An manchen Tagen soll er bis zu drei Bilder gemalt haben. Diese Rekord-Zahlen sind mit ein Grund, warum weltweit so viele Picasso-Museen kunstbegeisterte Besucherströme anlocken und etliche Ausstellungen gleichzeitig über dieses „Leitfossil der Kunst des 20. Jahrhunderts“ gezeigt werden. Dabei ist es für Kuratoren gar nicht so einfach, Picasso stets in einem neuen Kontext zu präsentieren, runde Geburts- oder Todesgedenktage wirken auf Dauer ein wenig einfallslos. Die aktuelle Picasso-Ausstellung im Brüsseler Bozar (1) hat jedoch ein Thema aufgegriffen, das in vielerlei Hinsicht überzeugt. Picasso und sein Verhältnis zur Abstraktion, dieser Frage widmet sich Museumsdirektor Michel Draguet, der diese Ausstellung in enger Zusammenarbeit mit dem Pariser Picasso-Museum konzipiert hat. Ihm geht es darum, den spielerischen Umgang des Künstlers mit Realität und Abstraktion zu dokumentieren. Seine Werke seien nie komplett abstrakt, sondern stellen immer etwas dar. Zwar durchaus verfremdet, aber Gegenständliches bleibe erkennbar, betont Draguet.
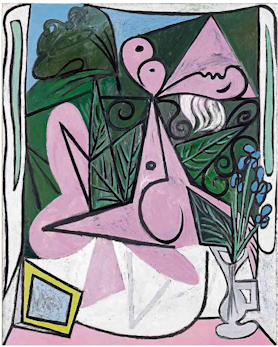
Akt mit einem Blumenstrauß aus Schwertlilien und einem Spiegel, Boisgeloup, 22. Mai 1934, Öl auf Leinwand, 162 x 130 cm,
Musée national Picasso-Paris
Succession Picasso – Sabam Belgium 2022 / CD, RMN-Grand Palais. Foto: Mathieu Rabeau
Der weibliche Blick eine Parallelausstellung
Miradas de Mujeres (Der weibliche Blick) beleuchtet derzeit im „Bonar“ die Sicht der belgischen Künstlerin Isabelle de Borchgrave auf Frida Kahlo, eine Vertreterin des Surrealismus aus Mexiko. Die Ausstellung läuft zeitgleich im Bazar mit der Picasso-Präsentation. Sowohl die weibliche Sichtweise auf die gesellschaftliche Rolle der Künstlerin als auch ihre gemeinsame Leidenschaft für Stoffe und Farben werden in dieser sehenswerten Sammlung thematisiert.
Das Atelier – sein Labor und Ort der Kreativität
Bevor Besucher sich mit diesen charakteristischen Merkmalen in Picassos Kunstwerken auseinandersetzen, werden sie von großflächigen Portraits des Künstlers und Fotografien aus seinem Atelier empfangen. So können sie nachvollziehen, wie Picasso gearbeitet hat und, dass sein Atelier für ihn in erster Linie Werkstatt war, eine Art Labor, der faktische Ort seiner Kreativität. Hier hat er über seine Motive nachgedacht, sie ausgewählt. Picasso ging – anders als die meisten seiner künstlerischen Zeitgenossen – nicht raus auf die Straße oder ins Cafe. Er wanderte nicht durch die Natur, um Eindrücke zu sammeln und sich inspirieren zu lassen. Das Atelier war sein Ort der Schöpfung.
Wie die Ausstellung versucht, Kinder und Jugendliche an Picassos Kunst heranzuführen, ist ebenfalls bemerkenswert. In mehreren Kreativräumen können sie – wie in einer Werkstatt – mit Holzstücken experimentieren, kleine Zettel bemalen und sie zu einem Puzzle auf einer Wandfläche zusammenfügen. Abstraktion wird hier als Kinderspiel vorgeführt.

• Ich male nicht, was ich sehe.
• Ich male, was ich denke.
• Alles was ich liebe,
• bekommt einen Platz in meinen Bildern.
Pablo Picasso
.
.
.
.
.
.
Musiker, Mougins, 26. Mai 1972, Öl auf Leinwand, 194,5 x 129,5 cm, Musée national Picasso-Paris, 4 Succession Picasso – Sabam Belgium 2022 / RMN-Grand Palais. Foto: Adrien Didierjean
Der letzte Schritt fand nicht statt
140 Arbeiten zeigen die wichtigsten Etappen, die die Verbindungen zwischen Picasso’s Werk und der abstrakten Kunst markieren. Um die Essenz abstrakter Malerei zu verstehen, ist die Beschäftigung mit Picasso immer sinnvoll, weil er diese Kunstform grundlegend beeinflusst hat. Dabei fällt auf, dass sich selbst namhafte Kunstexperten in der Bewertung nicht einig sind. Die einen bezeichnen ihn als „Erfinder der Abstraktion“, andere, wie Michel Draguet sagen: „Picasso ist kein abstrakter Künstler“. Gewiss, die Abstraktion ist nie die Erfindung eines Einzelnen gewesen. Vielmehr hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein ganzes Netzwerk von Künstlern und Intellektuellen dazu beigetragen, diese Kunstform zu entwickeln. Es hat seine Zeit gedauert, bis man sich ein abstraktes Bild überhaupt vorstellen konnte, ein Bild, das nichts mehr abbildet. Picasso hat diesen letzten Schritt nie getan, weil für ihn die Malerei stets mit den Dingen der Welt verbunden blieb. Dahinter verbirgt sich offenbar das Geheimnis, warum Picassos Werk so viele Besucher anzieht – weil es unsere Fantasie anregt, um letztlich doch ein Stück Realität zu erkennen.
„Ich male, was ich denke“
„Das Gemalte kann zum Beispiel ein Gefühl darstellen“, so interpretiert Museumsdirektor Draguet den Begriff der Abstraktion. Diese Beschreibung rückt die Ausstellung eindrucksvoll in den Mittelpunkt – mit den ausgewählten Bildern, aber auch mit dokumentierten Zitaten von Picassos: „Alles was ich liebe, bekommt einen Platz in meinen Bildern“. Oden „Ich male nicht, was ich sehe. Ich male, was ich denke.“ Dieser gefühlsbetonte Ansatz im künstlerischen Wirken begleitet Picasso von seinen ersten kubistischen Experimenten aus dem Jahr 1907 bis hin zu seinen Spätwerken um 1970, die vom so genannten „Action Painting“ beeinflusst sind. So war die Gitarre ein Musikinstrument, von dem Picasso besonders liebevoll schwärmte. »Flasche, Gitarre und Fruchtschale“ (1922) und zahlreiche andere Gitarren-Motive, sowie eine eindrucksvolle Reliefskulptur zeigen, wie sehr dieses Instrument – nicht akustisch, sondern visuell – im Zentrum seiner Arbeit stand. Als Motiv für das Ausstellungsplakat wurde das Klebebild „Violine und Partitur“ (1912) ausgewählt.
Bilder, die unsere Vorstellungskraft beflügeln
Zu sehen sind in der Ausstellung im Königlichen Kunstmuseum auch Zeichnungen, Skizzen, Entwürfe und kleinere Skulpturen, die erkennen lassen, wie Picasso mit Farben, Materialien und Gegenständen experimentiert hat. Die Präsentation endet mit einer berühmten Arbeit, die zu einem Aha-Erlebnis einlädt: Dem großformatigen Bild „Die Küche“ (1948). Selbst wenn auf diesem Gemälde kein Küchenutensil so dargestellt wird, wie wir es herkömmlich kennen, so vermittelt das Bild – meist auf dem zweiten Blick – den Eindruck einer Kücheneinrichtung. Runde, weiße Flächen, Kreise und Linien verbinden den Betrachter gedanklich mit Tellern, Töpfen und Herdplatten. Unsere Vorstellungskraft wird freigesetzt, um den Bildinhalt zu definieren. Diese beispiellose Art der visuellen Stimulierung macht den Besuch einer Picasso-Ausstellung immer wieder zum Erlebnis.
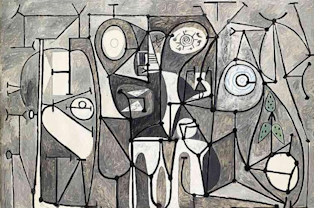
.
.
.
Die Küche, Paris, November 1948, Öl auf Leinwand, 175 x 252 cm, Musée national Picasso-Paris, Succession Picasso – Sabam Belgium 2022
© RMN-Grand Palais. Foto: Mathieu Rabeau
(1) „Bozar“ = Abkürzung für „Musees royaux des Beaux-Arts de Belgique“
„Picasso & Abstraction“, www.fine-arts-museum.be, dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Tickets 17 Euro, Senioren 12 Euro, Studierende 7 Euro, Katalog 39,90 Euro, noch bis zum 12. Februar 2023.
Die Zeit als Medium und Werkzeug
Kunst mit den Mitteln der Filmhistorie: Fiona Tan
im Amsterdamer EYE-Filmmuseum
Von Rotger Kindermann
„Will Fiona Tan „ihre eigene Ausstellung“ besuchen, setzt sie sich aufs Fahrrad und ist in zehn Minuten vor Ort. Nur wenige Kilometer entfernt von ihrem Amsterdamer Studio liegt das EYE-Filmmuseum, ein architektonisch spektakulärer Bau, dessen aufsteigende Linien die Hafen-Skyline dominieren. Tan, deren Foto-, Film- und Installationsarbeiten inzwischen weltweit in Chicago, London, New York oder Paris präsentiert werden, ist für ihren neuen Film „Footsteps“ tief in das Archiv des EYE hinabgestiegen und hat alte, beeindruckende Filmdokumente hervorgeholt. Sie zeigen den niederländischen Alltag, ein Leben in ständiger Wechselbeziehung zwischen Land und Wasser. Das Meer, mal Stimulus für Handel und Schiffsbau; mal Bedrohung, der man durch mächtige Deichbauten entgegentrat. Wasser ist überall in den Stummfilmszenen, die meist hart arbeitende Menschen zeigen. Mit hohen Gummistiefeln waten sie durch die Fluten, schleppen Säcke auf schaukelnde Kähne, schneiden Reet für die Dächer ihrer Häuser. Junge Mädchen in typisch holländischer Tracht flechten Körbe, Kinderarbeit war vor hundert Jahren ein normaler Vorgang. Blonde Jungs in Pluderhosen posieren vor der Kamera, im Mundwinkel dicke Zigarren, in deren Rauchwolken sie volljährig wirken wollen. Aufgezeigt wird auch eine wachsende Technisierung die von den Arbeitskräften roboterartige Bewegungsabläufe verlangt. Andererseits erleichtert der massenhafte Einsatz von Dampfmaschinen viele Produktionsvorgänge.
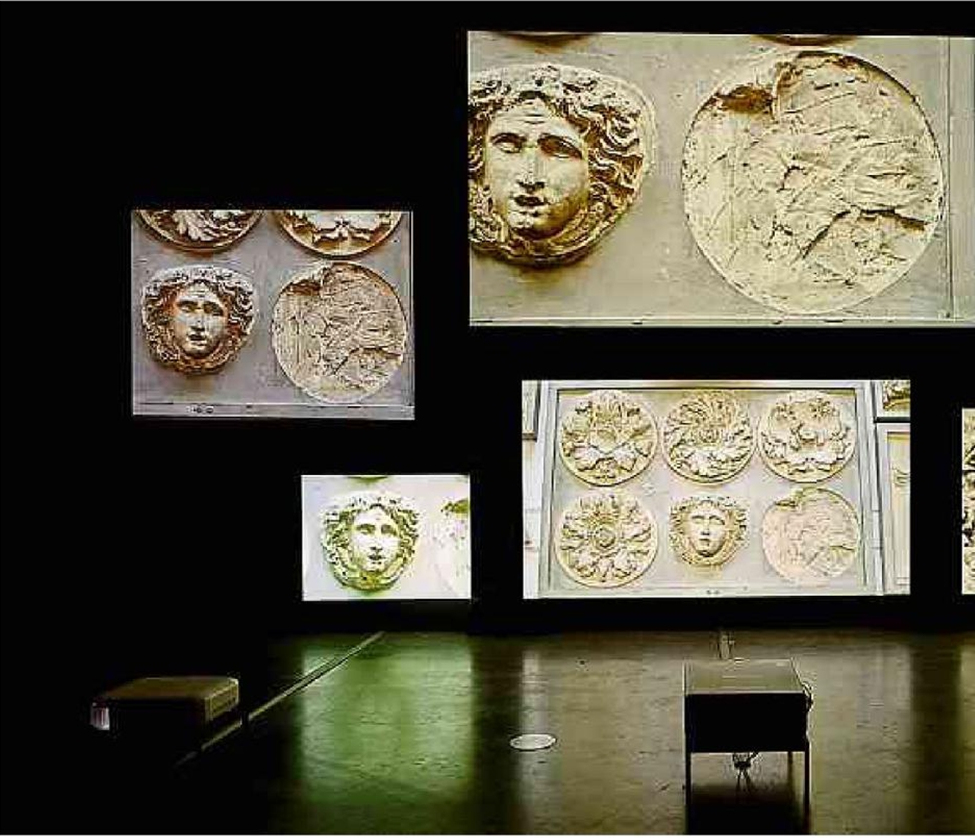
Faszination für Archivmaterial
Aus unserer Perspektive zeigen diese Bilder von hart arbeitenden Menschen auf eindrucksvolle Weise einen sozialen, aber in erster Linie soziokulturellen Blick auf die damalige Gesellschaft – so wie wir ihn heute in TV-Dokumentationen auf skrupellose Produktionsbedingungen in Asien und Afrika richten. Die in Indonesien geborene Künstlerin mit chinesisch-australischen Wurzeln hat hier offenbar eine besondere Sensibilität entwickelt, die sie zu einer kritischen und zugleich poetischen Sichtweise auf diese Zeit befähigt. „Tan betrachtet die Zeit als Medium und Werkzeug“, heißt es treffend im Begleitkatalog zur Ausstellung. Und kaum woanders ist die Zeit besser dokumentiert als in historischen Filmarchiven, die unsere Erinnerung aufrechterhalten. In ihren Werken offenbart sich Tan „als eine unermüdliche Forscherin, die in den Tiefen verstaubter Bibliotheken, geheimnisvoller Museen und bodenloser Archive unentwegt ihren Themen nachspürt 1.“Sie verwertet ihre Fundstücke, um neue Narrative zu entwerfen, die sich zwischen verschiedenen Kulturen entwickeln.
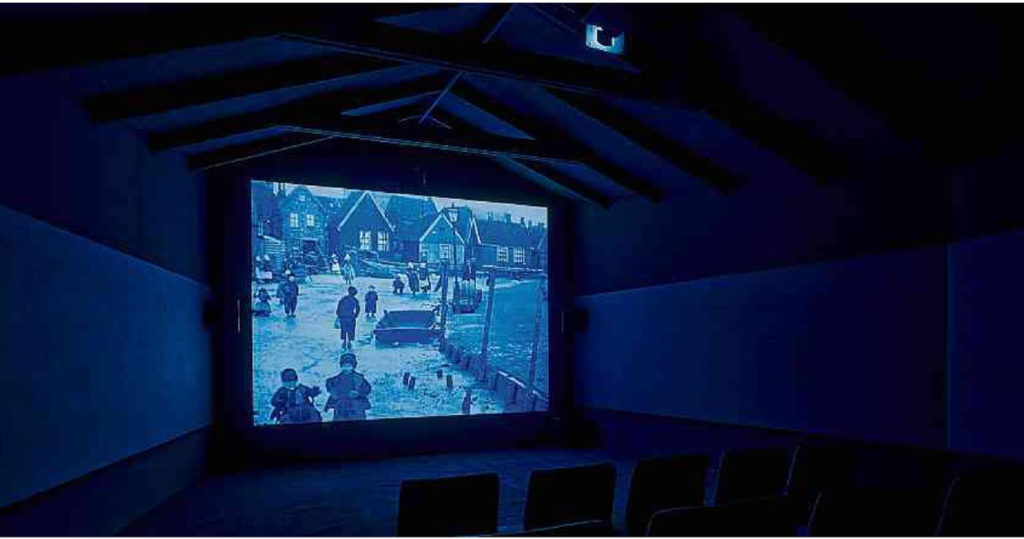
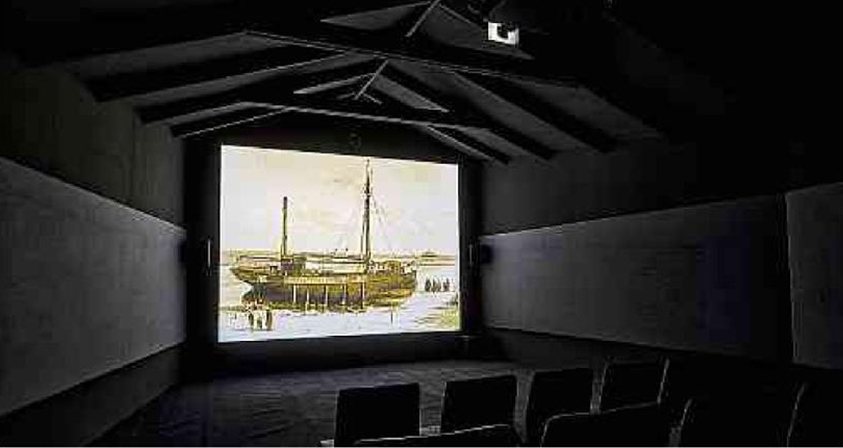
Fiona Tan, Footsteps, 2022, Ausstellung Fiona Tan, Mountains and Molehills, Eye Filmmuseum Amsterdam, 2022. Foto: Atelier Hans Wilschut
Liebevolle Briefe von ,,Pap“
Für die Szenen von »Footsteps“ hat Tan auch auf ihr Familien-Archiv zurückgegriffen. Sie werden mit Texten aus Briefen zusammengefügt, die Tan Ende der 80er Jahre, als sie gerade in die Niederlande gezogen war, von ihrem Vater erhalten hat. Ohne die Niederlande jemals besucht zu haben, wusste Tan’s Vater aus seiner Schulzeit in Indonesien viel über das Land im fernen Europa. Die handgeschriebenen Briefe hat Tan aufbewahrt und nutzt sie nun zur Vertonung mit einer weichen Stimme aus dem Off. Darin wechselt ihr Vater mühelos zwischen sehr persönlichen Schilderungen und Ereignissen, die sich gerade auf der Weltbiihne abspielten. Die liebevoll formulierten Schriftstücke beginnen jeweils mit „Liebste Fiona“, einige davon sind im Ausstellungskatalog dokumentiert. Man erfährt die Gedanken von „Pap“ zum Fall der Berliner Mauer, zum Zusammenbruch der Sowjetunion oder zum Tiananmen-Massaker in Peking. Zwischen Bild und Ton liegen etwa achtzig Jahre Zeitdifferenz. Die beiden, auf den ersten Blick völlig unverbundenen Ebenen des Films, finden zusammen zu einer Reflexion über globale Vernetzung, kulturelles Erbe und über die Frage, wie man seinen Platz in der Welt findet. Solche außergewöhnlichen, willkürlichen Verschmelzungen tauchen immer wieder in Tan’s Arbeiten auf.
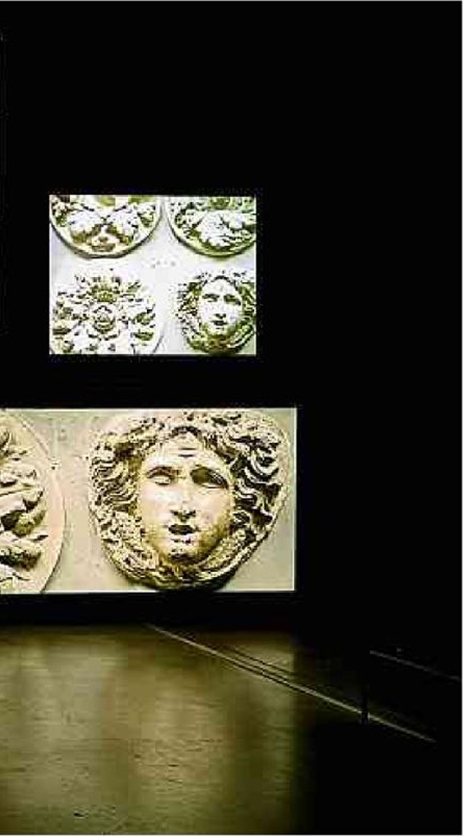
Fiona Tan ,,Inventory% 2012, in der Ausstellung ,,Fiona Tan, Mountains and Molehills“, Eye Filmmuseum Amsterdam, 2022. Foto: Studio Hans Wilschut
Foto oder Film?
»Footsteps“ ist das aktuelle Werk der Künstlerin und Kernstück dieser Retrospektive im EYE- Film-museum, auch optisch herausgehoben. Um den gut 90-minütigen Film anzuschauen, begibt sich der Besucher in die Nachbildung eines typisch holländisches Dorfhauses, ein roter Klinkerbau (aus Holz) inmitten des großen Ausstellungsraums. Darum herum zeigt das EYE unter dem Titel „Mountains and Molehills“ andere Werke der Filmmacherin aus den Jahren 2002 bis 2020. Besonders ins Auge fällt hier die Video-lnstallation Island“, die 2008 auf der schwedischen Insel Gotland entstand. Zunächst glaubt der Betrachter, es handelt sich um großformatige Fotos einer Küstenlandschaft, vereinzelte Bäume am Meeresufer, darüber ein leicht bewölkter Himmel. Bis er in der Natur eine minimale Bewegung erkennt, braucht es seine Zeit. Erst bei höchster Konzentration des Blicks wird man gewahr, wie sich im Wind Blätter berühren und Wolken weiterziehen. Der Eindruck dieser Installation liegt irgendwo zwischen einem „gefilmten Foto“ und einem „fotografierten Film“. Eine geradezu typische Tan-Kombination, die zur Meditation iiber zeitliche Abläufe einlädt.
Gute Geschichten plus…
Tan gräbt gerne fast vergessene Geschichten aus, setzt sie filmisch in Szene und ergänzt sie mit eigenen Wahmehmungen. Goethes „Italienische Reise“ inspirierte sie zu der Video-lnstallation »Gray Glass“, die 2020 für eine Ausstellung im Museum der Modeme in Salzburg geschaffen wurde und in Amsterdam erneut zu sehen ist. In dem Reisebericht entdeckte Tan die Erzählung von einem waghalsigen Transport kostbarer Spiegel von Italien nach Deutschland. Bei ,,Gray Glass“ folgt die Kamera einem Wanderer über verschneite Alpenpässe, der einen Spiegel auf dem Rücken trägt. Diese, zunächst rätselhaft anmutende, Art der Beförderung wurde tatsächlich im 18. Jahrhundert angewendet, weil die Spiegel zu zerbrechlich waren, um von Eseln getragen zu werden – wie es seinerzeit üblich war. Der Spiegel mit der darin vorüberziehenden Landschaft dient Tan als Metapher, um iiber die Zukunft der Erde und die Gefahren des Klimawandels nachzudenken. Für sie ist Aer Spiegel wie ein Auge“, das die permanenten Veränderungen beobachtet. Im Begleittext schwärmt Tan von der Schönheit der Natur. Auch mit dieser Installation schafft es die Kiinstlerin, ihr Publikum in eine mentale Richtung zu lenken, bei der sich am Ende alle eine Frage stellen: Wieviel Zeit bleibt dieser Welt noch?
In den Niederlanden angekommen
Die Zusammenarbeit zwischen Fiona Tan und dem EYE-Filmmuseum ist inzwischen vielfältig erprobt. Bereits 1999 verwendete sie Material aus der Sammlung des EYE hir ihre Arbeiten »Facing Forward“ und 2003 für „News from the Near Future“. Tan’s Fußspuren sind mittlerweile in den Niederlanden angekommen, 2009 vertrat sie das Land auf der Biennale in Venedig mit der Präsentation »Disorient“. Dass im EYE-Filmmuseum derzeit ein sehr komplexes und spannungsreiches künstlerisches Werk geboten wird, steht außer Frage.
——————————
(1) Aus: „Fiona Tan – Mit der anderen Hand“, Museum der Moderne, Salzburg
Die aktuelle Ausstellung wird begleitet von einem englischsprachigen Katalog, der zum Preis von 24,95 Euro erhältlich ist. Gezeigt werden Tan’s Werke noch bis zum 8. Januar 2023. EYE-Filmmuseum, 1031 KT Amsterdam, ljpromenade 1. Ticketpreis: 12,50 Euro, ermäßigt: 11 Euro. Öffnungszeiten täglich von 10 bis 19 Uhr.www.eyefilm.nl/Fionatan

Schwärmerei und Schmähung
Expressionismus-Schätze zum 100. Geburtstag des Museums Folkwang in Essen
Von Rotger Kindermann
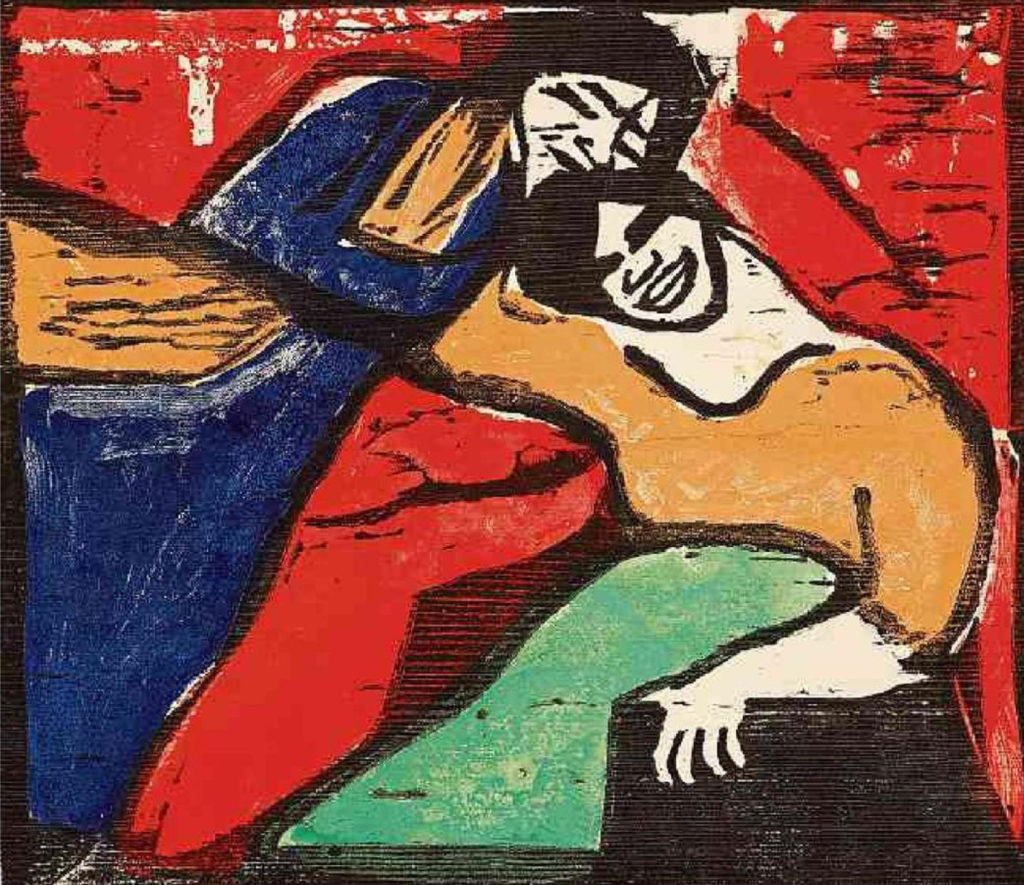
Am 19. Juli 1937 wurde in München eine Ausstellung über „Entartete Kunst“ mit rund 650 konfiszierten Kunstwerken aus 32 deutschen Museen eröffnet. Dass die Ausstellung über vier Jahre durch deutsche Stadte zog, um ein Millionen-Publikum zu erreichen, zeigt, welche Bedeutung das Nazi-Regime dieser Thematik beigemessen hat. Expressionisten, Kubisten, Dadaisten und andere Künstler der Moderne waren ihm von Beginn an suspekt, sie wurden als „undeutsch“ und „artfremd“ diffamiert. Als Ergebnis dieser inszenierten Kampagnen wurde u.a. das Folkwang Museum in Essen als „frankreichfreundlicher Snobistentempel“ bezeichnet. Ab 1937 ließ Reichspropagandaminister Joseph Goebbels diese Kunstrichtungen aktiv bekämpfen. Es wurde ein „Sonderreferat Entartete Kunst“ eingerichtet, das systematisch zugehörige Kunstwerke beschlagnahmte und mit der Katalogisierung, Inventarisierung und Verwertung begann. 21 000 Bilder, Skulpturen und andere Arbeiten fielen diesem beispiellosen Akt kultureller Selbstverstümmelung zum Opfer, von dem das Museum Folkwang mit seiner großen Expressionisten-Sammlung nicht verschont blieb, Ob ein GemAlde als „entartet“ stigmatisiert wurde, richtete sich dabei in erster Linie nach der rassistischen und politischen Beurteilung des Malers, weniger nach seinen stilistischen Ausdrucksformen. Von nun an durfte nur der den Künstlerberuf austiben, der arischer Abstammung war und nicht durch „kulturbolschewistische“ Werke von sich reden machte. Deutsche Kunst stand völlig 1m Dienst der NS-Regimes und seiner Rassenideologie.
Bilder mit Vergangenheit
Mit diesem historisch-politischen Hintergrund sollte jeder vertraut sein, der die Ausstellung
„Expressionisten am Folkwang: Entdeckt – Verfemt – Gefeiert“ besucht. Denn hier werden nicht nur Werke bekannter Expressionisten aneinandergereiht. Den Ausstellungsmachern gelingt es, Geschichte und öffentliche Wahrnehmung dieser avantgardistischen Kunstrichtung nachzuzeichnen – eine wechselhafte Abfolge zwischen Schwärmerei und Schmähung. Man erkennt, welche Odyssee ein ausgesondertes Gemälde bestehen musste. Die verschlungenen Wege und Eigentümerwechsel einzelner Kunstwerke werden klar dokumentiert. Detaillierte Inventarlisten aus Goebbels Sonderreferat belegen die Kaufpreise, die Daten des Besitzwechsels oder die Namen der Erwerber. Bei der Verkaufsaktion profitieren ausländische Museen und Privatsammler, die gegen Devisen günstig in den Besitz dieser Meisterwerke kamen. Diesen Vorgängen widmen sich gleich mehrere Beiträge im Ausstellungskatalog, in denen die Abwicklung der Käufe bzw. die oft komplizierten Rückkäufe und Rettungsbemühungen von Bildern beschrieben werden.
Mit Leidenschaft und Spürsinn
Von Beginn an war Folkwang eine Heimstatt für Expressionisten. Seit seiner Gründung im Jahr 1902 durch den leidenschaftlichen Kunstsammler Karl Ernst Osthaus – damals noch in Hagen – machte es sich einen Namen als „Vorkämpfer aller Kunst, die ein „Weiter“ in der Entwicklung bedeutet“ (Erich Heckel). Für die Jubiläums-Ausstellung wurden die von Osthaus erworbenen Gemälde Ernst Ludwig Kirchners wieder zusammengebracht und mit anderen Werken kombiniert, die eine enge Verbindung zwischen Künstler und Museum dokumentieren. An der Brücke-Ausstellung 1910 nahmen Maler wie Erich Heckel, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff teil. Ihre jetzt wieder gezeigten Bilder zählen heute zu den Hauptwerken des frühen Stils der Brücke, wie z.B. Schmidt-Rottluffs Haus am Bahnhof. Die teilweise Rekonstruktion der Sammlung von Werken Egon Schieles ist ebenfalls ein Höhepunkt dieser Expressionisten-Schau. Mit ausgeprägtem Spürsinn begann Osthaus 1911 Werke des Künstlers zu erwerben und zeigte sie ein Jahr später in einer Ausstellung. Nun wird Schieles Schaffen anhand von bedeutenden Leihgaben, darunter das Gemälde Tote Stadt und die Aquarelle Sitzendes Mädchen und Stehendes Mädchen in kariertem Rock – erneut gewürdigt.
Gelungene Rekonstruktionen
Die wechselvolle Geschichte wird in „Expressionisten am Folkwang“ besonders anschaulich im Werk der Künstlerin Paula Modersohn-Becker. Bereits 1913 wird ihr Schaffen in einer großen Retrospektive am Folkwang gezeigt. Aus dieser Ausstellung erwirbt Osthaus ihr Selbstbildnis mit Kamelienzweig. Es wird 1937 zusammen mit 1400 anderen Kunstwerken beschlagnahmt, in München zur Schau gestellt und von den Nazi-Kulturbarbaren als „entartet“ gebrandmarkt. Von dort geriet es in eine Privatsammlung und konnte 1957 zurückgekauft werden. Folkwang hat jetzt die Retrospektive zu Paula Modersohn-Becker in Teilen rekonstruiert und das Selbstbildnis mit elf weiteren Leihgaben kombiniert, die ebenfalls 1913
in Hagen zu sehen waren. Nach fast 110 Jahren begegnen sich die Bilder jetzt erneut. Aktuell
präsentieren 31 Künstler und Künstlerinnen (darunter Gauguin, Matisse, Marc, Münter, Kandinsky, Lehmbruck, Nolde) insgesamt 250 Meisterwerke aus der eigenen Sammlung und
von internationalen Leihgebern das großartige Spektrum der expressionistischen Kunstszene.
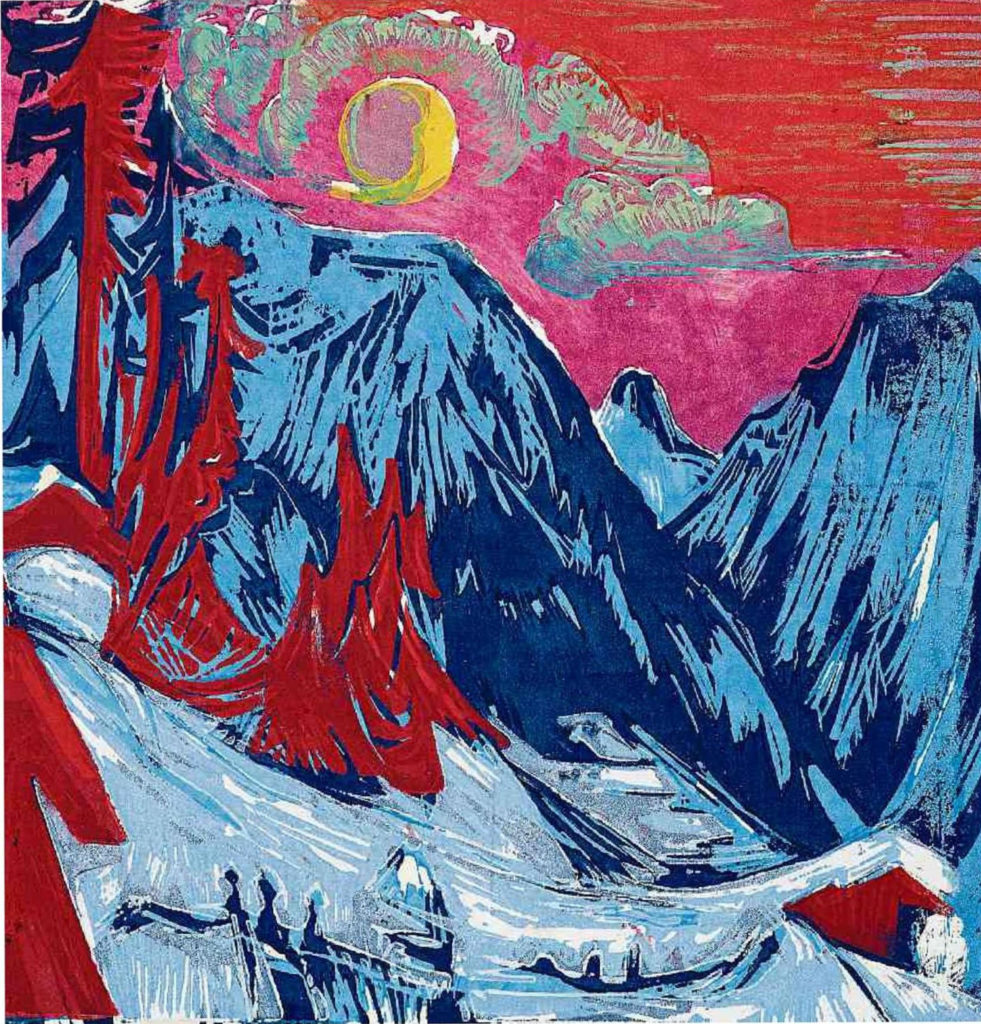

Museum Folkwang, Essen
Neuaufbau und Anerkennung
Die enge Verbundenheit zu dieser Szene zieht sich wie ein roter Faden durch die Museumsgeschichte, die in der Folge des Domizilwechsels 1922 nach Essen fortgesetzt wurde. Bereits Ende November 1948 findet in den Raumen der Folkwang-Musikschule – nicht weit vom Standort des zerstörten Museums – die erste Ausstellung expressionistischer Werke nach dem Krieg statt. Schon Anfang der 50er Jahre begann der Neuaufbau der Kollektion und überraschend früh hatte sie wieder ein Niveau erreicht, das sich mit der Sammlung von vor 1933 messen konnte. Als dann der Neubau des Museums fertiggestellt war, wurde er mit der viel beachteten Ausstellung Die Brücke – Eine Künstlergemeinschaft des Expressionismus
eingeweiht. Begeistert schrieb die Wochenzeltung „Die Zeit“: „Dort haben die expansiven Bilder der ,Brücke’-Maler den weiten Raum, den sie brauchen, um atmen und wirken zu können.“ So hat das Museum Folkwang in der damals noch jungen Bundesrepublik wesentlich dazu beigetragen, den Expressionismus in der Kunstwelt zu etablieren. Zugleich wurde es im Lauf der Jahre zu „einer wichtigen Institution für dessen Rezeption im Ausland.“ (Anna Brohm).
Expressionisten am Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Januar 2023. Tickets im Vorverkauf https://museum-folkwang.ticket-fritz.de, Eintrittspreis: 14 Euro, ermäßigt acht Euro, Freier
Eintritt in die ständige Sammlung. Katalog (deutsch/englisch) 38 Euro. www.museum-folkwang.de

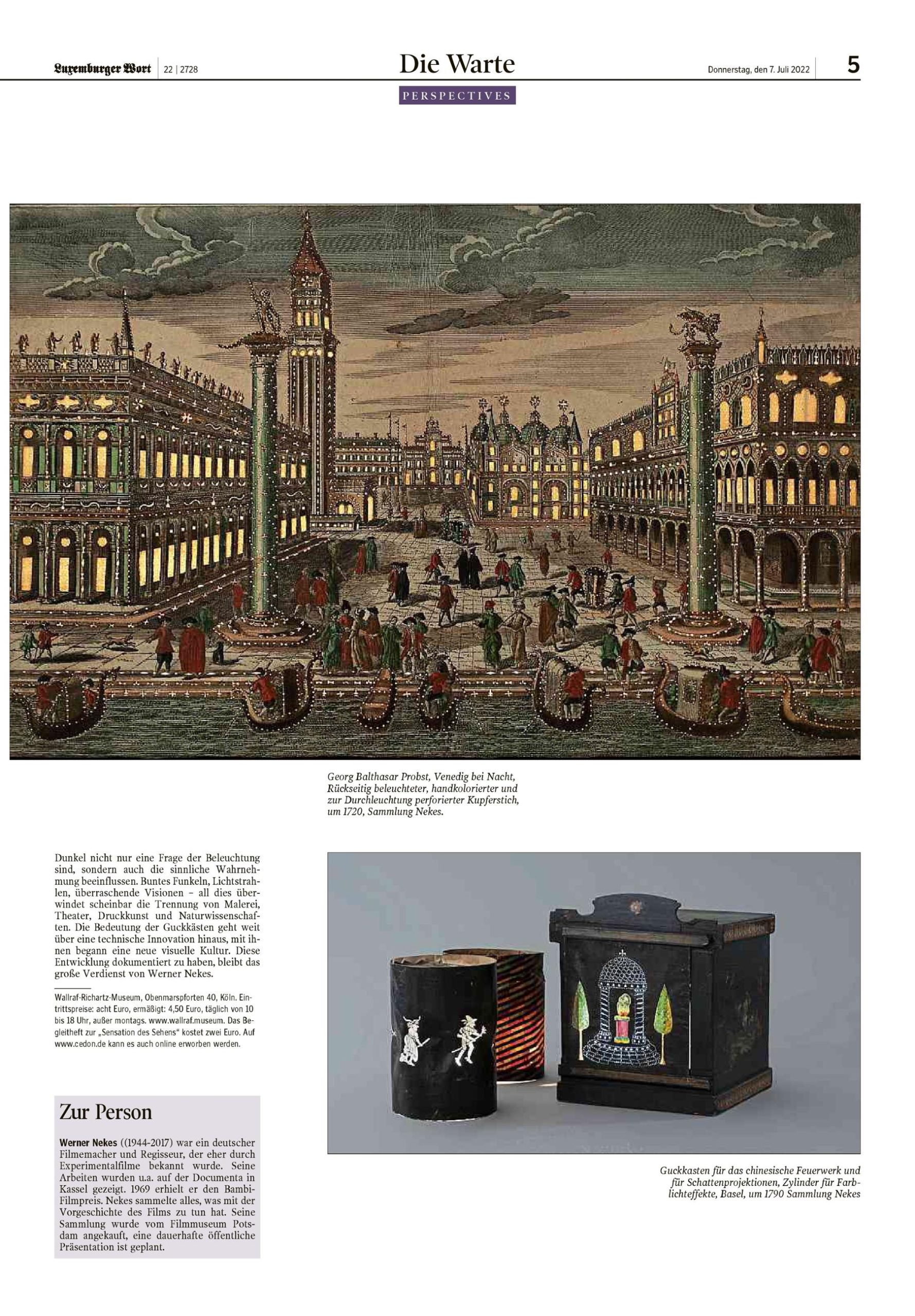
Luxemburger Wort: Donnerstag, den 12. Mai 2022 Die Warte
Einblicke in die Macht der Farben
Bundeskunsthalle Bonn zeigt ,,Farbe ist Programm“
Von Rotger Kindermann
Es ist ein schönes Erlebnis, mal wieder eine Kunstausstellung zu besuchen.
Endlich, nach Monaten der Reduktion und des Verzichts. Die Phantasie beflügeln und sich von der Farbenpracht stimulieren lassen. Doch schon nach wenigen Schritten durch die Ausstellung „Farbe ist Programm“ hält der Betrachter inne, er erblickt auf dem Einband eines Kinderbuches* die Farben Gelb und Blau – und hat zugleich die Bilder vom Krieg in der Ukraine im Kopf diese schrecklichen Bilder von Tod und Zerstörung. Farben sind immer auch Träger von Ideen und Vorstellungen, diese Kombination von Gelb und Blau, das Kolorit der ukrainischen Nationalflagge, strahlt heute eine hohe Symbolwirkung aus, ist Ausdruck von Solidarität und Hilfsbereitschaft. Die Tragweite von Farben wird hier anschaulich.
Viele Antworten zum Wesen der Farbe
Mit Farbe als Medium und ihrer künstlerischen, programmatischen und politischen Dimension befasst sich die Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle. Wie sehr Farben politisch einordnen, ist uns allseits bewusst: Braun steht für rechtsradikal, Rot für sozialistisch/sozialdemokratisch, Schwarz für konservativ oder Grün für umweltpolitisch. Aber es existieren auch völlig andere Sichtweisen, wie die des bekannten Anthroposophen Rudolf Steiner. 1921 sagte er einem Vortrag zum Thema „Das Wesen der Farbe“: ,,Rot ist der Glanz des Lebens. – Schwarz ist das geistige Bild der Toten. – Grün ist das tote Bild des Lebens“. Solch unterschiedliche Klassifizierungen lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Jedes Bild, jede Installation auf dieser Ausstellung muss für sich gesehen und verstanden werden. So kann der Betrachter die Macht der Farbe unbefangen auf sich wirken lassen.
Anhand von 50 bedeutsamen, meist zeitgenössischen und einigen kunsthistorischen Exponaten aus 150 Jahren zeigt die Bundeskunsthalle den wachsenden Einfluss von Farbe bis heute. Zeitlich beginnt die Ausstellung bei den ersten Farbfotografien und einem der ersten handkolorierten Filme. Zu sehen ist das berühmte Experiment des schottischen Physikers James Clerk Maxwell, der anlässlich eines Vortrages über die Farbwahrnehmung erstmals das Prinzip der additiven Farbmischung in Form einer Projektion durch rotes, blaues und grünes Licht bewies. Die fotografisch-filmischen Projekte führen bis zu dem Tag, als Farbe erstmals in Deutschland das TV-Programm eroberte. Am 25. August 1967 drückte der damalige deutsche Vizekanzler Willy Brandt auf einen großen roten Knopf um das farbige Fernsehzeitalter zu eröffnen.
Beeindruckend ist das breite Kaleidoskop, mit dem das Thema in den Blick genommen wird. Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Wirkkraft von Farbe beginnt im Foyer der Bundeskunsthalle. Farbig bedruckte Tücher des kürzlich verstorbenen US-Konzeptkünstlers Lawrence Weiner schweben über den Köpfen und provozieren mit klaren Aufrufen – wie: „Color without objects – color alone“. Ist Farbe also das wirksame Mittel, um künstlerischer Subjektivität Ausdruck zu verleihen? Insbesondere in der Malerei hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Farbe eine Eigenständigkeit erhalten, deren Wirkung sich in den ausgestellten Werken zeigt.
Da sind die Arbeiten von Ethel Adnan (1925-2021), die von der Schönheit der Welt erzählen und von der „Unschuld der Farbe“. Oder das Experiment „Woman and Smoke“ der Amerikanerin Judy Chicago, eine Pionierin für feministische Kunst. Sie filmt junge Frauen in einem Wüstengebiet, die in künstlich erzeugten Farbwolken tanzen. So werden ihre bunten Körper zu Gemälden in einer trostlosen Landschaft. Eine Inszenierung, die einem psychedelischen Trip gleichkommt und zum Mitmachen einlädt. Im Werk des jungen deutschen Malers Carsten Fock wird Farbe zum meditativen Raumerlebnis. Das Violett als Symbol der Besinnung, der Ruhe und inneren Einkehr beherrscht die Wandflächen. Eine vergleichbar kontemplative Wahrnehmung gilt für das frische, duftende weiße Blumenbouquet von Willem de Rooij, das im abgedunkelten Ambiente wie eine elegante Augenweide anmutet. Ein Anblick der jeden trübsinnigen Gedanken beiseiteschiebt.
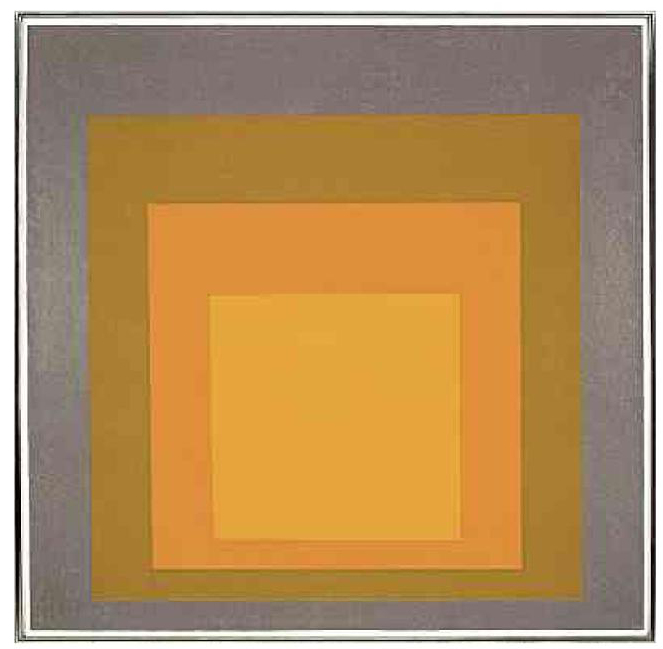
(c) VG Bild-Kunst Bonn 2022, Courtesy Privatsammlung Köln
Farbe – immer öfter ein Bekenntnis
Die Ausstellung präsentiert darüber hinaus aktuelles künstlerisches Schaffen, das Farbe verwendet, um Machtverhältnisse und Wirtschaftsinteressen hervorzuheben und zu hinterfragen. In den vergangenen Jahrzehnten haben Künstler*innen Farbe immer stärker eingesetzt, um Identität und Diversität hervorzuheben. Ein typisches Beispiel ist das Farbspektrum der Regenbogenflagge, mit der ein gesellschaftspolitisches Bekenntnis dokumentiert wird. Die Verwendung von Farbe in der „schönen Markenwelt“ wird eher am Rande thematisiert, die sog. ökonomischen Farbsysteme und
-kombinationen – von Nivea bis IKEA. Wenn es zutrifft, dass 85 Prozent der Käufer eines Produkts die Farbe als Hauptgrund für ihre Kaufentscheidung nennen, könnte die Ausstellung diesen farbpsychologischen Aspekten mehr Raum widmen. Die Verwendung von Farben kann auch weniger redliche Zwecke verfolgen – von der gezielten Manipulation bis zur Tarnung.
Die gesamte Ausstellungsarchitektur beeindruckt durch eine durchlässige Struktur mit vielen Durchblicken und möglichen Wegen. Sie stellt zugleich sicher, dass jedes ausgestellte Werk auch die Platzierung aller anderen Elemente beeinflusst. Dieser freie, nicht geleitete Parcours durch die riesige Ausstellungshalle sei ein bewusster Teil der Inszenierung, sagt Liam Gillick, britischer Künstler und einer der Kuratoren, „die sicherstellt, dass wir keine universelle Ausstellung produzieren, sondern einen Essay – einen ,Teil Eins‘.“ Dazu kamen alle Kurator*innen der Bonner Bundeskunsthalle zu Austausch und Diskussion zusammen. Das legt die Vermutung nahe, dass in dieser Runde bereits über einen zweiten Teil nachgedacht wird. Eine Weiterführung scheint allein aufgrund der Fülle des Themas angebracht.
* Kinderbuch „Das kleine Blau und das kleine Gelb“,
von Leo Leonni, Verlag Oetinger, 48 Seiten
Bis 8. August in der Bundeskunsthalle in Bonn, Eintritt 11 Euro, ermäßigt 7 Euro, freier Eintritt bis einschl. 18 Jahre, www.bundeskunsthalle.de
Luxemburger Wort: Donnerstag, den 02. Dezember 2021 Die Warte
Expressionistisches Farbenspiel
Das Von-der-Heydt Museum in Wuppertal zeigt ,,Brücke“ und ,,Blauer Reiter“
Von Rotger Kindermann
Das Von der Heydt-Museum, inmitten der Wuppertal« Fußgängerzone, ist ein mächtiges Gebäude aus der Zeit des Klassizismus. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurden hier immer wieder spektakuläre Ausstellungen gezeigt, es gehört heute zu den ersten Adressen in der deutschen Museumslandschaft. Gelungen ist dies durch zahlreiche Kooperationen mit anderen Museen, deren Sammlungen sich ergänzten und so neue Blickwinkel auf eine Kunstepoche erlaubten, Das gilt auch für die aktuelle Ausstellung „Brücke und Blauer Reiter“, in der diese beiden expressionistischen Künstlergruppen im direkten Vergleich zusammentreffen. Wie die Idee dazu – im Kontakt mit dem Museum Buchheim in Bernried am Starnberger See und der Kunstsammlung Chemnitz – entstand, schildert Museumsdirektor Dr. Roland Mönig so: „Alle drei Häuser hüten hochrangige Sammlungen zum deutschen Expressionismus. Angesledelt an weit voneinander entfernten Orten im Süden, Westen und Osten der Republik tun sie sich zusammen, um ein Schlüsselthema der Kunstgeschichte darzustellen. Das mussten wir einfach machen“
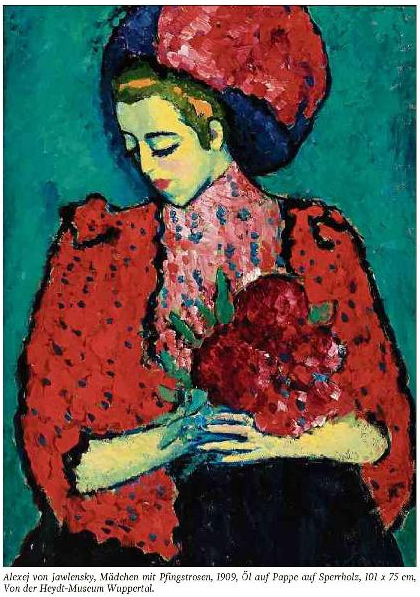
Vorreiter eines neuen Sehens
Eine Zusammenschau von „Brücke“ und „Blauem Reiter“ hat es zuletzt vor 25 Jahren gegeben. Sie war also überfällig und sie ist in Wuppertal gut gelungen. Im Fokus steht dabei die revolutionäre Kernzeit des Expressionismus von 1905 bis 1914, also von der Gründung der „Brücke“ bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Beide Künstlergruppen verstanden sich als Vorreiter eines neuen Sehens und Denkens, aber es gab auch Unterschiede – nicht nur bei künstlerischen Sicht weisen und Themenwahl. So war die „Brücke“ im strengen Wortsinn eine Künstlergruppe, die von vier Architekturstudenten (Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff) in Dresden gegründet wurde und Später nach Berlin zog. Man malte zusammen, man organisierte gemeinsam Ausstellungen, war freundschaftlich verbunden. Der Name „Blauer Reiter“ dagegen basiert auf einem Buchtitel, eine Arbeit von Franz Marc und Wassily Kandinsky über aktuelle Entwicklungen im Bereich Kunst und Kultur. Es handelte sich dabei eher um eine lockere Formation, hervorgegangen aus der Neuen Künstlervereinigung München (N.K.V.M), mit wechselnden Teilnehmern, zu der auch Komponisten und Kunstkritiker gehörten. Beide Gruppen kannten einander, schätzten und verachteten sich auch bisweilen. Sie stellten gelegentlich sogar miteinander aus, hatten die dieselben Galeristen und Sammler.
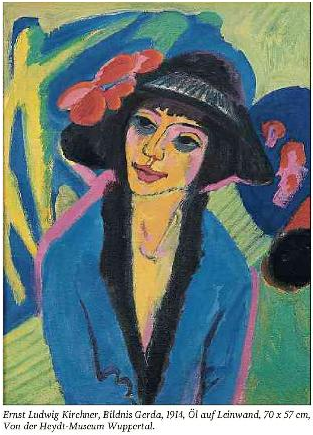
Gemeinsamkeiten und Kontraste
Im Von-der-Heydt-Museum wird durch die Auswahl an Werken der Spannungsbogen zwischen den beiden Gruppen sichtbar, wie sie sich einerseits als Kontrapunkte zueinander verhalten, aber auch wie ein künstlerischer Gleichklang herrscht. Auffällig sind die Kontraste zwischen „Brücke“ und „Blauem Reiter“ im Umgang mit der Gattung Portrait. Während Erich Heckel bei der Inszenierung seines Freundes Pechstein dessen physische Präsenz hervorhebt, umgibt Gabriele Münter ihren Lebensgefährten Kandinsky mit einer intellektuellen Aura. Für die unterschiedlichen Betrachtungsweisen stehen auch zwei Aktbilder. Sie muten in Form und Stil zunächst fast gleich an: zwei üppige Nackte erscheinen bildfüllend und farbenprächtig. Doch während Ernst Ludwig Kirchner („Brücke“) pralle Erotik damit ausdrückt, hat der Betrachter bei Franz Marc („Blauer Reiter“) eher den Eindruck von Intimität und Vertrautheit. Mehr Übereinstimmung besteht bei der Wahl der Motive, von der quirligen Großstadt-Szene bis zum Landschaftsbild, das den Wunsch nach einem freien, unbeschwerten Leben in der Natur ausdrückt.
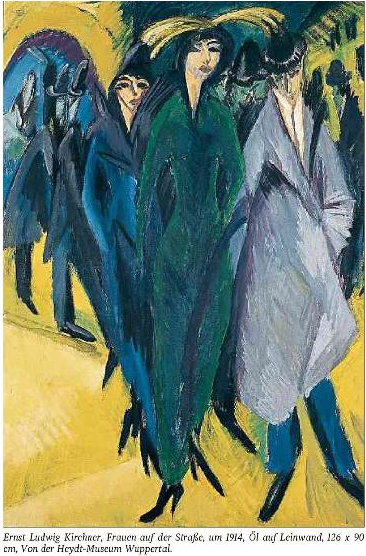
Erbslöh als Wegbereiter
Die Ausstellung hat ihren Schwerpunkt eindeutig bei Gemälden, die größtenteils aus den drei Sammlungen stammen und klug miteinander kombiniert wurden. Nahezu allgegenwärtig sind kraftvolle Farben und scharfe Konturen, in ihrer Radikalität typisch für diese Kunstrichtung. Die üppigen Farbgewitter Emil Noldes, Max Pechsteins leuchtendes Südsee-Paradies, Franz Marcs Alpenszene, die an eine Industrielandschaft erinnert, oder Kirchners ‚Frauen auf der Straße“ ziehen die Besucher in ihren Bann. Für viele Künstler der beiden Gruppen spielen auch grafische Techniken eine wichtige Rolle. Münters Farblinolschnitte zeugen von der Auseinandersetzung mit Jugendstil und Symbolismus. Die Holzschnitte von Franz Marc aus der Schaffensphase, in der seine bekannten Tierbilder entstehen, bestechen durch Klarheit und Schwarz-weiß-Kontraste. Auf einer Expressionismus-Ausstellung in Wuppertal dürfen natürlich Werke von Adolf Erbslöh nicht fehlen. Ihm ist es zu verdanken, dass diese neue Kunstströmung schon früh im Tal der Wupper Beachtung fand. Denn dieser im damaligen Barmen‘, aufgewachsene Maler hatte die Neue Künstlervereinigung München mitbegründet und bereits 1910 eine Ausstellung des Vereins ins städtische Museum Elberfeld vermittelt, die später auch in der Kunsthalle Barmen gezeigt wurde, und viel Aufsehen erregte.
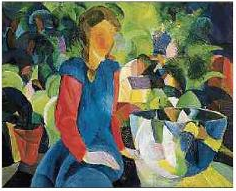
81×105 cm, Von-der-Heydt-Museum Wuppertal
Ein Geist von Aufbruch
Der Ausstellung gelingt es nicht nur das künstlerische Spektrum von ‚Brücke“ und ‚Blauem Reiter“ umfassend abzubilden, es werden zugleich die Einflüsse der „Väter der Moderne“ gezeigt. Vincent van Gogh, Paul Gauguin, und Paul Cdzanne sind als prominente Wahlverwandte und Wegbereiter des deutschen Expressionismus vertreten. Auch der Kubismus – Pablo Picasso und Jean Metzinger als Beispiele – war für ‚Brücke“ und ‚Blauer Reiter“ gleichermaßen ein wichtiger Bezugspunkt. Insgesamt wurden 160 Hauptwerke von 31 Künstlern ausgewählt, davon 90 Gemälde und 70 Arbeiten auf Papier. Einige sind Leihgaben aus international renommierten Häusern wie dein Stedelijk Museum in Amsterdam. Diese gelungene Zusammenarbeit erfreut Kurator Dr. Mönig ganz besonders, bezeichnet er doch den Expressionismus als seine Leidenschaft und sagt: „Bis heute spürt man die Energie in den Arbeiten dieser Künstler – eine Frische und einen Geist von Aufbruch und Neubeginn, der ansteckend wirkt. Sie haben Konventionen gesprengt und eine neue Vorstellung von Kunst begründet.“ Da bleibt nur die Hoffnung, dass die Anziehungskraft dieser Ausstellung in Zeiten der Pandemie noch lange währt und das Museum die Schau wie geplant bis zum 27. Februar 2022 zeigen kann.
Der Stadtname Wuppertal entstand erst 1929 nach der Zusammenlegung von Elberfdd, Barmen und weiteren kreisfreien Städten.
Luxemburger Wort: Donnerstag, den 17. Juni 2021 Die Warte
Belgische Kunst:
Das Kunstmuseum am Meer, wie sich das Mu.Zee in Ostende nennt, will künftig seine gewaltige Sammlung visueller Ktmst aus Belgien seit 1880 nicht nur verwalten, sondern auch zeigen.
Mu.Zee einst Kaufhaus, jetzt Museum, Eine neue Heimat für „belgische Kunst“
Von Rotger Kindermann
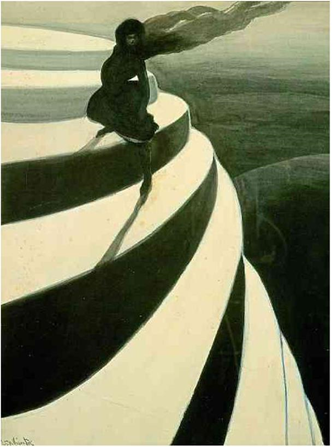
Fotos: Steven Decroos
Ein kleiner Bildband lässt seine Betrachter schmunzeln und zugleich staunen. „Belgien Solutions“ heißt das Buch, die Fotografien zeigen, wie man in Belgien mit geringem Aufwand improvisiert, Komplikationen auf Straßen oder an Gebäuden kreativ umgeht, stets zu ungewöhnlichen, mitunter radikalen Lösungen bereit ist. Als in Ostende 1981 die Erfolgsgeschichte eines Kaufhauses der ehemals größten belgischen Genossenschaft S.O.E. (Spaarzaamheid Economie Oostende) zu Ende ging, wurde eine „belgian solution“ gesucht. Wie kann man ein Warenhaus mit einer riesigen Verkaufsfläche auf drei Stockwerken anderweitig nutzen? Abriss und Neubau, Umbau zu Büroetagen – alles aufwendige und riskante Pläne. Fünf Jahre später war die kreative Lösung gefunden, und es öffneten sich die Türen zu einem Museum. Das Provinzialmuseum für moderne Kunst (PMMK) hatte eine neue Heimat gefunden.
„Stoffenverkoop“, so ist die große Wandzeichnung im Eingangsbereich übertitelt, der einzige verbliebene Hinweis darauf, dass hier einmal Textilien, Möbel, Kühlschränke und Spielwaren verkauft wurden. Die Architektur des zwischen 1950 und 55 erbauten Hauses kann fraglos als zukunftsweisend bezeichnet werden. Helles Tageslicht dringt durch die riesige Glasfront in alte Stockwerke. Eine beeindruckende Räumlichkeit entsteht aufgrund der hohen Geschosse, die seitlichen Balkone bieten unerwartete Blicke auf die 200 Kunstwerke und gegenüberliegenden Häuserfassaden. Durch die Demontage nicht tragender Wandsegmente wurden neue Sichtlinien geschaffen. Die Wandlung vom Kaufhaus zum Museum ist mit wenigen baulichen Eingriffen gut gelungen.
Nicht mehr versteckt im Depot
Nach der Zusammenlegung des PMMK mit dem Museum der schönen Künste schlug im Jahr 2008 die Geburtsstunde des neuen Museums unter dem Namen „Mu.Zee“. Und in Folge der Corona geschuldeten Zwangsschließung ist nun wieder der Zeitpunkt für einen Neustart gekommen. Das Kunstmuseum am Meer, wie sich das Mu.Zee auf seiner Homepage nennt, wird künftig seine gewaltige Sammlung (über 2 000 Werke) visueller Kunst aus Belgien seit 1880 nicht nur verwalten, sondern auch zeigen und „nicht mehr im Depot verstecken“, betont die neue Museumsdirektorin Dominique Savelkoul. Denn kein anderes belgisches Museum habe sich so klar auf das Sammeln von Werken von Künstlern aus Belgien fokussiert. Es gehe auch um eine historische Übersicht.
Dabei ist die Frage unausweichlich, ob der Begriff „belgische Kunst“ zu leicht missverstanden werden kann, weil diese nationale Kategorie kaum im Einklang mit dem globalen Anspruch von Kunst steht. Künstler agieren heute in internationalen Netzwerken und verstehen sich als Repräsentanten bestimmter Stilrichtungen. Doch das sieht Wouter Davidts von der Universität Gent, ein Berater des Mu.ZeeKonzepts, anders: „Diese Präsentation könnte man als Apell für mehr Aufmerksamkeit und Pflege für die Geschichte der in Belgien entstandenen Kunst verstehen.“ Es bleibe noch eine Menge zu tun, um die Wertschätzung für diese Kunst zu steigern. Immer wieder mal wird thematisiert, ob die Bildung der Nation (1830 Staatsgründung) auch zu einer eigenen belgischen Kunst-Identität geführt habe. Ein gewisser Trend zur Abgrenzung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus erkennbar. Junge Talente zwischen Ostende und Lüttich lehnten es ab. sich einer Kunstbewegung – etwa dem deutschen Expressionismus oder dem französischen Fauvismus – anzuschließen.
Ein Ort der Inspiration
Dabei besteht kein Zweifel, dass das junge Königreich große Künstlerpersönlichkeiten hervorgebracht hat. Besonders zu nennen sind die beiden „Ostende-gebürtigen“ Künstler James Ensor (1860-1949) sind Leon Spilliaert (18911946), die beide im Mu.Zee ihren festen Platz haben. Schon früh wurde Ensor das Etikett „Maler der Masken‘ verliehen, doch sein Werk ist weitaus vielfältiger. Ensors Bilder vereinen heilere und düstere Elemente, sein Werk reicht
von Landschaften über Stillleben bis hin zu christlichen Motiven.
Dominique Savelkoul ist besonders dankbar, dass das Königliche Museum für die Schönen Künste in Antwerpen dem Mu.Zee 26 Gemälde von Ensor als langfristige Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. Außerdem sollen alle drei Monate wechselnde Ensembles mit Zeichnungen ausgestellt werden. Auch Lion Spilliaert erweckte mit seinen Malereien und Aquarellen schon früh internationales Interesse. In seinen Arbeiten suchte er nach hellen, kontrastreichen Farben und er schematisierte und vereinfachte die Formen immer weiter. Exemplarisch dafür steht das im Mu.Zee gezeigte Bild „Schwindel‘ (1908). Als Spilliaert zwei Jahrzehnte nach Ensor in Ostende zur Welt kam, hatte sich die Stadt im Eiltempo vom kleinen Fischerdorf zum mondänen Badeort gewandelt. Leopold 1., Belgiens erster König, wählte den Küstenort als Sommerresidenz, die königliche Entourage und wohlhabende Kaufleute ließen sich an der Strandpromenade nieder. Und natürlich inspirierte dieser Wandel beide Künstleraber ebenso das außergewöhnliehe Licht und der einmalige Rhythmus des Meeres.
Ambitionierter Anspruch
Eine beachtliche Zahl anderer Werke namhafter Künstler – wie des Surrealisten René Magritte oder von Raoul De Keyser, einem Vertreter der Abstrakten Malerei – beherbergt das ehemalige Kaufhaus. Dazu eine stattliche Sammlung von Skulpturen, Illustrationen und Zeichnungen – eine bewusst subjektive Präsentation, die nicht nach Vollständigkeit strebt, wie die Direktorin ausdrücklich unterstreicht. Die neue Konzeption hat das junge – vorwiegend weibliche – Team des Museums in nur vier Monaten zusammengestellt, nachdem der Zeitpunkt der Wiedereröffnung feststand. Unvermeidliche Umbauten wurden in Rekordzeit gestemmt. Wohl wissend, dass diese Maßnahmen nur provisorischen Charakter haben, weil 2024 die großen Renovierungsarbeiten beginnen sollen. Aber man wollte die Sammlung so schnell wie möglich wieder mit der Öffentlichkeit teilen und ein breites Publikum erreichen.
Klares Ziel ist dabei, alle Gesellschaftsschichten als Besucher zu gewinnen, auch solche, die bisher von Kunst keinerlei Notiz nehmen. ,,Für sie wollen wir unsere Türen jeden dritten Mittwoch im Monat gebührenfrei öffnen“, sagt Direktorin Savelkoul und hofft auf weitere Förderer. Ihr Anspruch ist durchaus ambitioniert: Mu.Zee möchte ein Museum mit zutiefst menschlichem Charakter sein, mit dem freundlichsten Empfang des Landes. Es hat den Anschein. dass die soziale genossenschaftliche Idee des alten Kaufhauses nicht völlig in Vergessenheit geraten ist.
—————–
Geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 1730 Uhr. Eintrittspreise für Einzelpersonen von 26 bis 64 Jahre zwölf Euro, ab 65 Jahre und für Gruppen zehn Euro, Jugendliche 13 bis 25 Jahre ein Euro. Kinder bis zwölf Jahren frei. www.muzee.be
Wer Leben und Werk von James Ensor genauer entdecken will, sollte das Ensor-Haus In Ostende (sein Wohnhaus, Atelier und interaktives Erlebniszentrum) besuchen. Kontakt: Info@jarnesensorhuis.be.
Auch die Kunsthalle Mannheim (kuma.art) widmet derzeit James Ensor eine Sonderausstellung. Noch bis 1. Oktober 2021
Belgian Seluliens von David Helbich, Hrsg. MediuMER, B9000 Gent
Die Sammelrichtlinie von Mu.Zee ist eine Besonderheit. Über Jahre hinweg wurden ausschließlich Werke von belgischen Künstlern gesammelt. Seit 2010 wurde dies aul Werke von Künstlern ausgeweitet, die in Belgien leben und arbeiten und keine belgische Staatsbürgerschalt besitzen.
Luxemburger Wort: Donnerstag, den 14. Januar 2021 Die Warte, Donnerstag, den 14. Januar 2021
Als das Proletariat zum Sujet der Kunst wurde
Wuppertal würdigt Engels mit „Vision und Schrecken der Moderne“
Von Rotger Kindermann
Das sagt Antje Birthälmer, und versucht dabei, ihre Enttäuschung hinter einem Lächeln zu verbergen. Sie ist Kuratorin der Ausstellung „Vision und Schrecken der Moderne“, die das Wuppertaler Von der Heydt-Museum zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels zeigt. Oder zeigcn wollte, Seit die Museen am 2. November in Deutschland schließen mussten, schlummern die 152 Kunstwerke, Gemälde, Grafiken und Skulpturen hinter den dicken Mauern des klassizistischen Bauwerks. Nun hofft Birthälmer, dass man Anfang Februar wieder öffnen kann: „Irgendwann muss ja auch dieser Lockdown beendet werden“. Die Ausstellung könnte dann noch bis Ende März oder auch länger gezeigt werden. Die Museumsleitung bemüht sich intensiv, die Fristen Für Leihgaben zu verlängern, und glücklicherweise stammen fast 65 Prozent der gezeigten Exponate aus eigenen Beständen. „Es ist ein herausragender Stadtschatz, den wir hier sichtbar machen wollten und ein spannender Beitrag zum Engetsjahr 2020″, betont die Kuratorin,
Die Misere der Arbeitswelt
Das mit der industriellen Revolution entstandene Wirtschaftssystem des Kapitalismus, dessen Auswirkungen Engels kritisch analysierte, hat zu technischen Fortschritten aber auch zu schweren sozialen Konflikten geführt. Diese Gegensätze wurden damals von der Kunst eindrucksvoll reflektiert und bilden jetzt in der Wuppertaler Präsentation einen starken Kontrast. Hier im Tal der Wupper, in der Stadt Barmen, wurde Engels 1820 geboren, hier lebte er die meiste Zeit bis zu seinem Umzug nach London im Jahr 1870, hier wurde er als Gesellschaftstheoretiker und Revolutionär beeinflusst. (Wuppertal als Stadtname entstand 1929 durch Zusammenlegung mit Nachbarstädten.)
Seit dem frühen l9. Jahrhundert war dieser Talkessel ein Zentrum der Textilwirtschaft und damit ein Ausgangspunkt der Industrialisierung. So beginnt die Ausstellung mit Stadtansichten aus dieser Zeit, sie zeigen riesige Fabriken, rauchende Schlote, Industrieanlagen, die wie mächtige Festungen aus der Landschaft ragen. Kolosse aus Stahl verdrängen die Natur – besonders im Ruhrgebiet. Gezeigt werden Werke von Malern, die sich von der neuen, industrialisierten Welt einfach faszinieren ließen. Und es gab andere, die unmittelbar in die grauen Gesichter der Lohnabhängigen blickten, Dort, hinter dem Mauerwerk einer Fabrikanlage, umgeben von Glut und Hitze, schuften „Die Krupp’schen Teufel“, so der Titel eines Ölbildes von Heinrich Kley. Zunehmend mehr

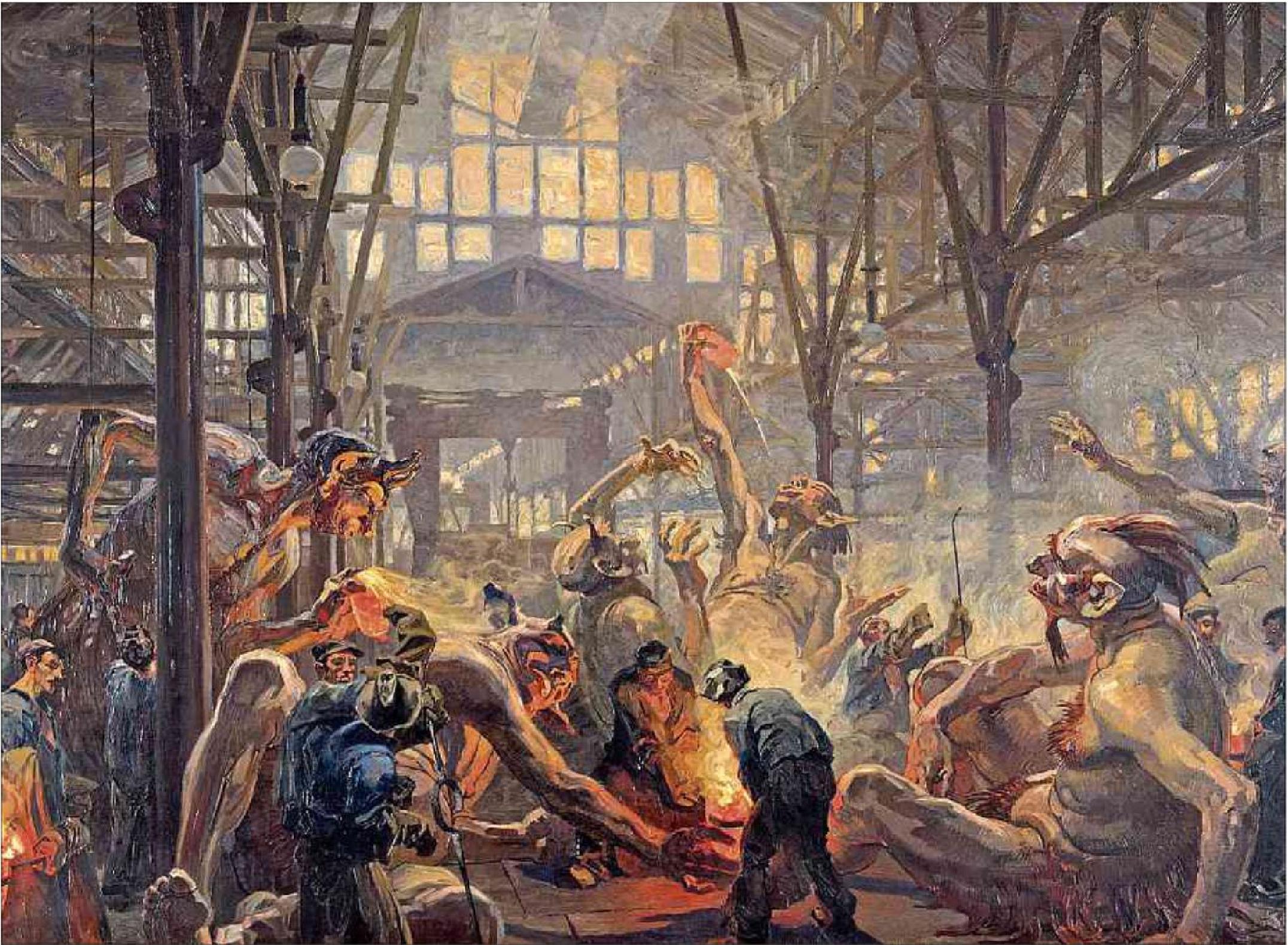
Künstler thematisierten die oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Eindrucksvoll beschreibt das großformatige Gemälde „Arbeiterinnen“ von Hans Baluschek, einem Vertreter des kritischen Realismus, die Misere und Monotonie der Arbeitswelt. Es stellt Frauen als Bestandteil einer Menge dar, die „durch endlose Schufterei zu entindividualisierten Typen“ wurden.
Ein geschönter Blick
Andererseits entsteht durch die industrielle Dynamik ein wohlhabendes und selbstbewusstes Wirtschaftsbürgertum. Wer dazu gehörte, ließ sich gerne von Heinrich Christoph Kolbe, einem Kunstmaler aus Düsseldorf, porträtieren. Diese andere Perspektive der Gesellschaft zeigen die ausgestellten Porträts, die den wachsenden Wohlstand der Kaufmannsfamilien im Tal der Wupper dokumentieren. Einige Künstler der Düsseldorfer Malerschule verdingten sich in der zweiten I Hälfte des 19. Jahrhunderts als Porträtmaler und fanden so in den nahe gelegenen Industrieregionen ihr Auskommen. Dieser „geschönte Blick“ und die mehr kommerzielle Ausrichtung der Kunst wird von der Ausstellung in gleicher Weise abgebildet. So wird der Betrachter auf eine Reise mitgenommen, die zeigt, wie sich gesellschaftliche Umbrüche in der Kunst widerspiegeln.
Kunst wird zur „Rebellion“
Die Visionen eines Friedrich Engels haben zweifelsohne Gesellschaft und Politik ebenso nachhaltig wie dauerhaft beeinflusst. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde das Proletariat zu einem Sujet der Kunst, wie Antje Birthälmers Beitrag im Begleitkatalog zur Ausstellung beschreibt. Diese „Rebellion“ engagierter Künstler verschärfte sich mit dem ersten Weltkrieg, der als unheilvolle Allianz aus Industrie und Militarismus eine zeitgeschichtliche Zäsur markierte. Wie Kunst mehr und mehr politisch agierte, veranschaulichen u.a. die expressionistischen Arbeiten von Conrad Felixmüller. Not und Elend der Nachkriegszeit hat Max Beckmann eindringlich dargestellt. Andere, wie die Gruppe der „Kölner Progressiven“, begegneten dem aufkeimenden Faschismus und Nationalismus mit Satire und scharfer Sozialkritik. Oder sie stellten die Kunst in den Dienst einer humanistischen Utopie. Die Nähe zum Gesellschaftsverständnis von Engels springt ins Auge, auch wenn Utopien, wie die Künstler selbst erkannten, oft trügerisch sind.
Geist einer neuen Zeit
Ein eigenes Kapitel innerhalb der Ausstellung bildet die Fotografie der Industriearchitektur: Von ihrer Entdeckung abbildungswürdiger Bauten und Gegenstände in den 1020er Jahren durch Fotografen wie Eugen Balz, in dessen Werken sich der Geist einer neuen Zeit ausdrückt, erlebt der Besucher den Wandel fotografischer Dokumentation in einer ganzen Industrieepoche. Fotos von Bahnhöfen der Wuppertaler Schwebehahn führen zurück zum Ursprungsort des Themas. Diese geniale – und weltweit einmalige – Konstruktion einer über dem Fluss schwebenden Bahn steht noch heute für industriellen Aufbruch und war bei ihrer Fertigstellung im Jahr 1901 die gelungene Verwirklichung einer „Vision der Moderne.
Info Am 28. November wollte Wuppertal den 200. Geburtstag von Friedrich Engels feiern. Das Von der Heydt-Museum hatte zur festlichen Kreativ-Aktion eingeladen, musste jedoch Corona bedingt absagen. Museumsdirektor Dr. Roland Mönig hält aktuell ,ein komplettes Herunterfahren des öffentlichen Lebens für wichtig und sinnvoll“, obwohl man die Hygienevorgaben stets vorbildlich umgesetzt habe. Das Museum ist bis zum 31. Januar 2021 geschlossen. Noch gibt es keinen Zeitpunkt für eine Neueröffnung. www.von-der-heydtmuseum.de |
Donnerstag, den 29 Oktober 2020 Die Warte | Luxemburger Wort |
Provokationen mit dem menschlichen Körper
Die Bundeskunsthalle Bonn zeigt Max Klingers Werk
Von Rotger Kindermann
So war das nicht geplant: Das Beethovenfest zum 250. Geburtstag des Komponisten musste die Stadt Bonn bis zum August nächsten Jahres verschieben. Beethovens Musik zu hören, das wurde wegen des Pandemie-Risikos abgesagt – aber ihn betrachten, das macht die Bonner Bundeskunsthalle jetzt möglich. Dort steht die monumentale, fünf Tonnen schwere Skulptur, die Max Klinger 1902 zu seiner Verehrung vollendet hat. Auch mit diesem Künstler verbindet sich ein Jubiläum: Bonn, die Geburtsstadt Beethovens, würdigt Klinger (,1857-1920) zu seinem hundertsten Todestag. Dieser Pionier des deutschen Symbolismus gehörte seinerzeit zu den bekanntesten, aber auch umstrittenen Künstlerpersönlichkeiten. Der Symbolismus prägte die Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er erhob die Vorstellungskraft zur wichtigsten Quelle der Kreativität. Beliebtes Thema des Symbolismus war die Verbindung von Erotik und Tod.
Beethoven als Göttergestalt
In Klingers Gesamtwerk nimmt die halb nackte Beethoven-Figur eine Schlüsselrolle ein. Sie markiert den Höhepunkt seiner künstlerischen Karriere. Es dauerte 17 lange Jahre, bis das Werk fertiggestellt war – angefangen von einer ersten Idee, die beim Klavierspiel im Pariser Atelier entstand, über die Anfertigung eines Gipsmodells bis zur Vollendung der Skulptur aus verschiedenen Marmorarten, Alabaster, Metallteilen und Elfenbeinschnitzereien. Dunkle Farbtöne lassen die Figur noch massiger wirken. Da thront der Musiktitan mit geballter Faust, gedankenschwer beugt er sich nach vorn und blickt auf den Adler zu seinen Füßen. Ein der Zeit enthobenes Genie oder doch eher Göttergestalt? War das Klingers Vorstellung?
Mit diesem Monumentalwerk avancierte der Leipziger Künstler – bis dahin hauptsächlich mit Radierungen bekannt – zum großen Bildhauer. Die Präsentation der Beethoven-Skulptur auf der XIV. Ausstellung der Wiener Secession (1902) verschaffte ihm internationale Aufmerksamkeit. ‚Niemals zuvor hat ein einzelnes Kunstwerk hier so die ganze Bevölkerung in Bewegung gebracht“, schrieb damals ein Kritiker. Doch die Wiener wollten das Komponistendenkmal nicht behalten, obwohl Beethoven seit 1792 hier gelebt hat. Vermutlich war es ihnen zu avantgardistisch. Auch Klingers Freundschaft mit Gustav Klimt war nicht hilfreich. Folglich wurde das Werk zunächst in Düsseldorf und Berlin gezeigt und gelangte schließlich nach Leipzig, wo es heute im Museum der bildenden Künste einen angemessenen Platz gefunden hat. Nun wurde die Skulptur nach langer Zeit mal wieder ausgeliehen zusammen mit anderen Klinger-Arbeiten. Über 200 Werke aus allen Schaffensbereichen Klingers werden an der Bonner Museumsmeile gezeigt, sein Werk umfasst neben Gemälden und Skulpturen eine reiche grafische Sammlung. Beim Betrachten wird deutlich, dass Klinger ‚durch und durch Europäer war“, wie Kuratorin Agnieszka Lulinska feststellt, Er bereiste Italien gleich mehrfach und ließ sich u. a. in Spanien, Frankreich oder Griechenland inspirieren. Dabei war er stets auf der Suche nach Marmorgestein, das er für seinen monumentalen Beethoven verwenden konnte. Häufig reiste Klinger für längere Zeit nach Paris, wo er sich mit Auguste Rodin anfreundete und mit dem ihn eine Art Seelenverwandtschaft verband. Beide Bildhauer stellen den menschlichen Körper in seiner natürlichen Nacktheit in den Mittelpunkt ihrer Kunst. „Die Sinnlichkeit ist ein Grundpfeiler des künstlerischen Wesens“, schrieb Klinger aus Paris. In vielen seiner Skulpturen aus der Zeit um die Jahrhundertwende finden wir Rodins Stilelemente wie seine ausgeprägte Modellierung der Körper wieder.
Der nackte Christus – Kunstskandal im Kaiserreich
Ob Klinger zu Meißel oder Pinsel griff, er verstand es, durch enthüllte Darstellungen zu provozieren. Besonders seine monumentale Komposition der Kreuzigungsszene mit einer nackten Christusfigur ist dafür exemplarisch. Im von strenger Moral geprägten deutschen Kaiserreich waren solche Gemälde ein Skandal, die konservative Kunstkritik schäumte. Um den
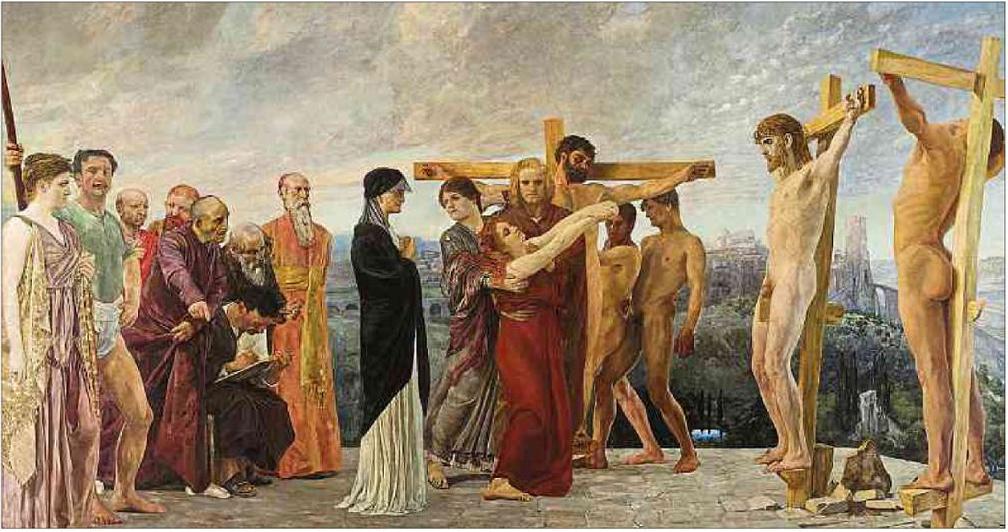
Foto: (c) InGestalt/Michael Ehritt
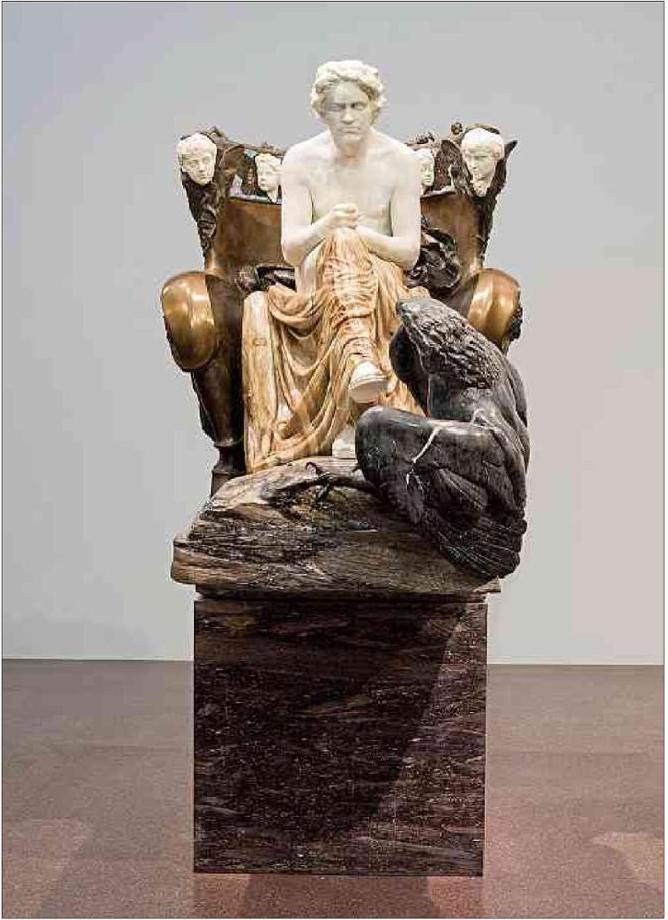
künstlerischen Affront in den Vordergrund zu rücken, hat man in Bonn die „Die Kreuzigung Christi“ mitten im Raum frei platziert. Das Bild hängt nicht vor einer Wandfläche, der Betrachter kann es umkreisen und sich so schrittweise der Szene nähern. Der Gekreuzigte wird nicht wie üblich in der Mittelachse abgebildet, Jesus wird zur Randfigur – nahe der rechten Umrahmung an ein schiefes Balkenkreuz genagelt. So bestimmt er die nach Klingers Worten „rechte, schwere, nackte Hälfte“.
Das Zentrum wird beherrscht von Maria Magdalena, die gerade in Ohnmacht fällt. Dahinter zwei junge unbekleidete Männer, deren Unterleibe sich aufreizend berühren. Während seiner Präsentation 1891 in München musste das Gemälde zum Teil verhängt werden, später übermalte Klinger den Schambereich Christi mit einem Lendentuch. Er nutzte dafür klugerweise wasserlösliche Farbe, so konnte man das Kunstwerk später wieder unzensiert in Augenschein nehmen.
Es erleichtert die Deutung der Kunstwerke, dass dem Besucher auch ein Blick auf den „privaten Klinger“ vermittelt wird. Da ist einmal die langjährige Liebesbeziehung zu Elsa Asenijeff, einer Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, mit der ein intensiver künstlerischer Austausch erfolgte. Sie verfasste eine maßgebliche Studie über den Entstehungsprozess der Beethoven-Skulptur. Das Paar blieb unverheiratet, trotz gemeinsamer Tochter, bis zum Wendepunkt dieser Beziehung im Jahr 1909. Da verliebte sich Klinger in die erheblich jüngere Gertrud Bock, zunächst Modell mit erotischer Ausstrahlung, dann Geliebte und treusorgende Haushälterin, die er kurz vor seinem Tod heiratete.
In dem 46 Blätter umfassenden Grafikzyklus, der in Bonn gezeigt wird, reflektiert Klinger nicht nur das explosive Verhältnis unter den Geschlechtern, sondern auch seine persönliche Situation. Die Zerrissenheit zwischen seiner vertrauten Lebensgefährtin Elsa und seiner jugendlichen Liebe Gertrud, die er ausdrücklich als wichtigste Inspiration für diesen Zyklus bezeichnet. Unstrittig ist, dass beide Frauen auf ihre Weise Klingers Kreativität beflügelt haben. Und es gibt wenige Künstler, die so vielseitig gearbeitet haben. Die Ausstellung macht deutlich, dass Klinger nicht nur Maler, Bildhauer und Grafiker war, er schuf auch dekorative Kunst wie silberne Tafelaufsätze oder gestaltete komplette Innenräume. Gleichgültig, wie oder wo Klinger agierte, man konnte sicher sein, dass er die Konventionen seiner Zeit überschritt.
Max Klinger und das Kunstwerk der Zukunft“, bis zum 31. Januar 2021 in der Bundeskunsthalle in Bonn. Anmeldung per E-Mail an vermittlung@bundeskunsthalle.de www.bundeskunsthalle.de
Luxemburger Wort 61 2661 – Die Warte – Donnerstag, den 1. Oktober 2020
Aus einer anderen Welt
Kulturraum Insel Hombroich präsentiert Terunobu Fujimori – ein Teehaus im
Zusammenspiel von Natur tmd Tradition
Von Rotger Kindermann
Kaum anderswo in Europa ist Japan so präsent wie an Rhein und Ruhr. Über 600 Firmen aus Nippon haben sich hier angesiedelt, darunter mehrere Europazentralen namhafter Konzerne. Jedes Jahr im Mai wird am Düsseldorfer Rheinufer das Japanfest gefeiert, ein spektakuläres Feuerwerk lockt eine halbe Million Zuschauer. Über 8 400 Japaner leben inzwischen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Wie so oft folgten den Investoren die Künstler und Kulturschaffenden, Bauten japanischer Architekten sind heute in aller Munde. Die Düsseldorfer Kunstakademie ist seit den 1990er-Jahren zum Magneten für junge Japaner geworden, einmal, weil sie durch Künstlerpersönlichkeiten wie Joseph Beuys oder Gerhard Richter Weltruf erworben hat – aber auch, weil ein Studium hier im Vergleich zur Heimat wesentlich günstiger ist. Kunstausstellungen mit Japanbezug finden regelmäßig in den Museen von Bonn, Köln oder Düsseldorf statt; prächtige japanische Gärten bereichern vielerorts die Parklandschaften.
Eigenwillige Formensprache
Tadao Ando ist so ein Name, der für Japans Einfluss in dieser Region steht. Auf Einladung des Düsseldorfer Kunstmäzens Karl-Heinrich Müller besuchte der renommierte japanische Architekt bereits 1994 die sogenannte Raketenstation, eine ehemalige NATO-Basis am Stadtrand von Neuss und heute Bestandteil des Kulturraumes Insel Hombroich. Zehn Jahre später wurde hier das von ihm entworfene Ausstellungshaus der Langen Foundation eröffnet, ein lang gestreckter, von einem Glasmantel umhüllter Betonriegel, der sich den topographischen Gegebenheiten anpasst.
Im krassen Gegensatz dazu steht seit Kurzem ein anderer Bau mit einer sehr eigenwilligen Formensprache: Das neue Teehaus von Terunobu Fujimori. Dieser bedeutende japanische Architekturhistoriker, der auch als Architekt international angesehen ist, konnte hier seinen naturnahen Baustil verwirklichen. Nicht Beton und Glas dominieren die Arbeiten, er will „moderne Architektur mit natürlichen Materialien gestalten“. „Ein Stein-Teehaus“ nennt Fujimori seinen Neubau, eine Bezeichnung, die aus dem Buddhismus stammt. Danach kann man die Wirkung eines Steins spüren, er lädt ein zur Reflexion. Fujimoris Gebäude erscheinen oft wie aus einer anderen Welt. Diese Charakterisierung trifft auf sein Teehaus in besonderem Maße zu.
Tief verwurzelte Tradition
Sieben kräftige Stämme wurden in die Erde gerammt, um es wie ein exponiertes Baumhaus in den Himmel zu heben. Da steht das Bauwerk, nur einen Steinwurf entfernt von Andos Glaspalast, ein wenig versteckt auf einem Hügel und erzeugt ungläubiges Staunen bei Besuchern. Ungewöhnlich ist seine dunkle, karbonisierte Holzfassade; mit Ausnahme der schmalen Stahltreppe, die nach oben führt, ist Holz das dominierende Material. So schwebt das Teehaus förmlich auf Höhe der Baumwipfel, emporgehoben durch die beiden Seitenflügel, die an Adler-Schwingen erinnern. Dahinter verbergen sich die bleiverglasten Schiebefenster, wenn sie bei einer Teezeremonie geöffnet werden. Offene Fenster sind für dieses Ritual von großer Bedeutung, denn es soll nach der Tradition des Zen-Buddhismus im Einklang mit der Natur stehen: Reinheit, Stille, Respekt und Harmonie sind die grundlegenden Prinzipien.
Dennoch erlaubt das Teehaus eine gewisse Anpassung an europäische Gebräuche: Die Gäste knien nicht auf Tatami-Matten, sie sitzen vielmehr an einem geschwungenen Tisch, in dessen Mitte die Feuerstelle für die Teezubereitung eingelassen ist. Bis zu sechs Personen finden hier Platz, um sich dem präzisen Ablauf einer Teezeremonie zu unterziehen. In Japan kann der Brauch schon mal viele Stunden beanspruchen. Doch auf der Neusser Raketenstation soll diese Art meditativer Gesprächsrunde erheblich verkürzt werden, versichert Frank Boehm, der Künstlerische Leiter der Stiftung Hombroich und Initiator des Teehaus-Projektes. Die Vorbereitungen für ein eigenes Zeremonie-Angebot – unter erschwerten Corona-Bedingungen – sind kurz vor dem Abschluss. Dann können sich Besucher zu festen Terminen (siehe Kasten) anmelden, um verschiedene Grüntees aus den typischen Schalen zu kosten: Zum Beispiel den dünnen Usucha oder den fast pastenartigen Koicha. Sie werden dabei erkennen, dass eine Teezeremonie keine „triviale Probierrunde“ ist, sondern vielmehr ein Ausdruck tief verwurzelter japanischer Werte und Traditionen.
Harmonie mit der Natur
Diesen Leitbildern begegnet man auch im nahe gelegenen Siza-Pavillon, wo eine Ausstellung Fujimoris Gesamtwerk näherbringt. Gezeigt wird u. a. eine Sammlung alter Teeschalen und anderer Gefäße, die zu einer Teezeremonie gehören. Zu sehen sind ferner die Originalskizzen und ersten Entwürfe für das ‚rheinische Teehaus“. Sie stehen ganz im Einklang mit anderen Teeräumen und Teehäusern, die Fujimori seit 20 Jahren in Japan gebaut hat und die auf Fotos dokumentiert werden. Beeindruckend ist ein Projekt, das er für einen namhaften japanischen Süßwarenhersteller (Ta-neya-Gruppe) realisiert hat. Eine Firmenzentrale, deren Konstruktion vollständig mit der sie umgebenden Natur harmoniert. Dabei liegt es nahe, dass die hier produzierten Süßigkeiten gerne bei Teezeremonien angeboten werden.
Bei Fujimori paart sich offensichtlich die Genialität bei der Verwendung natürlicher Materialien mit einem ausgeprägten Hang zur Ironie. Als Mitbegründer der ROJO-Society (Roadside Observation) sammelt er seit den 80er-Jahren Fotografien von kuriosen Baufehlern, Absurditäten und Planungsmängeln in urbanen Räumen. Es sind Bilder, die belustigen: Regenfallrohre in Schlangenform, unbenutzbare Treppen, missglückte Straßenmarkierungen oder Kanaldeckel mit menschlichem Antlitz. Gezeigt werden sie im kleinen Kinosaal des Siza-Pavillons, ein origineller Ausklang nach diesem Rundgang durch eine andere Kultur.
Die Fujimori-Exponate werden auf der Raketenstation (Stiftung Insel Hombroich) noch bis zum 29. November gezeigt, jeweils Freitag bis Sonntag, 12-17 Uhr. Nach der Winterpause wieder vom 5. Februar bis 11. April 2021 zu gleichen Zeiten. Eintritt: 5 Euro. Teezeremonien jeweils am Freitag ab 2. Oktober, 2-6 Personen, Preis ab 100 Euro.
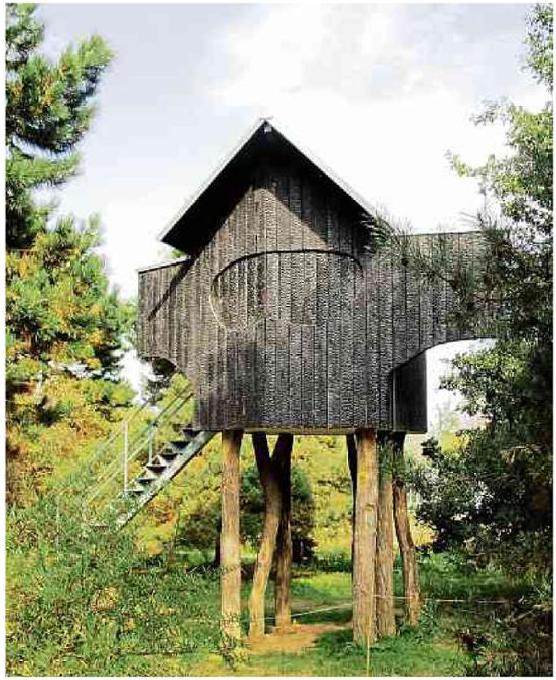
| Das Fujimori-Teehaus, eine begehbare Skulptur aus Holz in luftiger Höhe. Foto: Rotger Kindermann |
|
Vue hebdomadaire | Die Warte | Luxemburger Wort, Donnerstag. den 16. Juli 2020 |

Die Neuerfinderin des Kinos
Chantal Akerman, die Pionierin des feministischen Avantgardefilms – eine Ausstellung
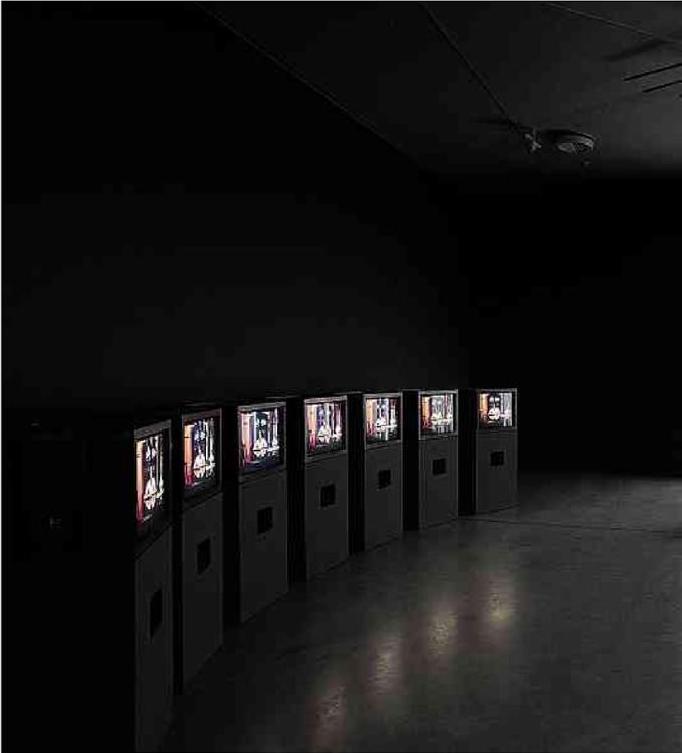
Die Innovatorin
Das „Eye Filmmuseum“ in Amsterdam zeigt mit „Passages“ eine Ausstellung über Chantal Akerman, die Erfinderin neuer Formen des Kinos.
Von Rotger Kindermann
Eine Gemeinsamkeit haben das „Eye Filmmuseum“ in Amsterdam und Chantal Akerman auf jeden Fall: Beide sind außergewöhnlich und beeindruckend. Der lang gestreckte weiße Bau des Eye liegt wie eine designte Luxusyacht auf dem Wasser, im Hinblick auf Eleganz und Lage vergleichbar mit den Opernhäusern in Oslo oder Sydney. Und Chantal Akerman war eine Pionierin des modernen Kinos, sie hat das Medium Film auf ihre Weise revolutioniert.
Noch bis zum 30. August zeigt das Eye Werke der belgischen Filmemacherin und Drehbuchautorin. Doch war Akerman wirklich ‚belgisch“ – nur weil sie 1950 in Brüssel geboren wurde? Ihre Familie kam aus Polen, genauer gesagt aus Tarnów, einem Mittelzentrum östlich von Krakau. Chantals Mutter, Tochter jüdischer Eltern, wurde 1928 hier geboren, zwei Jahre danach zog die Familie nach Brüssel. Ihr späterer Ehemann Jakob Akerman stammte aus Kazimierz, dem bekannten jüdischen Viertel Krakaus. Beide waren Holocaust-Überlebende, er in einem Versteck in Brüssel, sie in Auschwitz.
Dialog zwischen Leben und Tod
Es ist eine Familiengeschichte voller Tragik, dunkler Erinnerungen und beklemmender Tagebücher, die häufig in Chantal Akermans Filmen reflektiert wird. Spielt sie selbst eine Rolle, sieht man sie in der Gefangenschaft einer Wohnung oder eines einzigen Zimmers. Hätte es Akerman gefallen, einen Film über den Lockdown zu Corona-Zeiten zu drehen? In ihren Zellen stecke das Gefühl, sie selbst sitze in einem Gefängnis, sagte sie einmal in einem Interview. Diese Situation beherrscht auch ihre erste Filmerzählung, für die die damals 18-jährige Chantal die enge Küche ihrer Mutter als Drehort nutzte. Mit dem Kurzfilm „Saute ma ville“ (1968, 13 Min. Dauer) beginnt die Eye-Präsentation, ein für manch arglosen Betrachter eher beklemmender Auftakt. Nach rasender Kamerafahrt durch neblig-trübe Straßen betritt eine junge Frau (Chantal Akerman) den Hausflur, holt einen Brief aus dem Postkasten, läuft die Treppen hinauf. Jetzt geht sie in die Küche, Nudeln werden gekocht, anschließend hastig verschlungen. Mal wird Chaos angerichtet, dann wird der Boden gewischt, Schuhe geputzt – mitsamt den eigenen Beinen. Fröhlicher Gesang und Stille wechseln sich ab, die Rituale von Ordnung und Unordnung werden durchexerziert. Am Ende des Films dreht die junge Frau den Gasherd auf, Flammen entzünden den Brief, ihr Körper liegt auf dem Herd. Dann die Explosion – nur ein lauter Knall, kein Bild. Sie sprengt nicht irgendein Zimmer in die Luft, sondern die Küche, damals ein Hort für Mütter und Töchter!
Das Widersprüchliche an diesem Kurzfilm ist seine sprühende Energie, seine Lust an der Aktion und der vom aufgedrehten Gashahn entfachte Todesknall. Oder ein nur hörbarer Donnerschlag, der das Trauma des Überlebens symbolisiert? Von dieser Paradoxie sprach die Pariser Rabbinerin Delphine Horvilleur in ihrer Totenrede auf Chantal Akerman im Oktober 2015. Mit Blick auf die früh Verstorbene meinte sie, es gebe Menschen, die keine Friedhöfe brauchen, um die Nähe des Todes zu spüren, da sie ihn von Geburt an in sich tragen. Das Lebendige und das Tote befänden sich in ihren Herzen in einem unauflösbaren Dialog. Es bleibt eine Frage, ob sich Tod und Leben mehr befruchten, als dass sie sich ausschließen. Eine Antwort gibt die hebräische Bezeichnung für Friedhof, die übersetzt „Haus der Lebenden“ lautet.
Bereits in „Saute ma ville“ zeigt sich Akermans Regietalent, aus dem sie bald ihren eigenen Filmstil entwickelte. Mit dem Mittel langer Einstellungen, Frontalaufnahmen, extremer Kamerafahrten und präzise gerahmter Szenen lädt sie den Zuschauer ein, eine intime Beziehung zu dem gefilmten Bild aufzubauen. Auch bei der Vertonung ging sie eigene Wege.
Es gab einen dominierenden Sound, eine bewusst stilisierte Tonspur, die isoliert wurde. Natürliche Nebengeräusche wurden gegen null gefahren. Damit sollte die Illusion von Realismus von vornherein verhindert werden. Nach Akermans Verständnis waren natürliche Geräusche unerwünscht, weil zwei Personen im gleichen Raum niemals dasselbe hören.
In vielerlei Hinsicht waren ihre Filmarbeiten bahnbrechend. Sie war eine herausragende Künstlerin, weithin bekannt für ihre Videoarbeiten, die u. a. bei der Documenta in Kassel (2002) gezeigt wurden. Seit den 70er-Jahren galt sie als Pionierin filmischer Installationen, lange, bevor diese Form den Kunstbetrieb eroberte. „Akermans Ästhetik der Alltagserfahrung. ihr Überschreiten der Genregrenzen zwischen Spielfilm, Dokumentarfilm und Experimentalfilm, ihr Sinn für Zeiterfahrung jenseits der herkömmlichen Spielfilmdramaturgie machen sie zu einer Neuerfinderin der Formen des Kinos“, schrieb das Deutsche Filminstitut im Vorwort zu einer Akerman-.Lecture“ im Oktober 2018. In den fast 40 Arbeiten dominieren Frauenporträts oder sie haben feministische Themen zum Gegenstand. Dabei distanziert sich Akermans Bildsprache deutlich vom unterhaltenden Erzählkino.
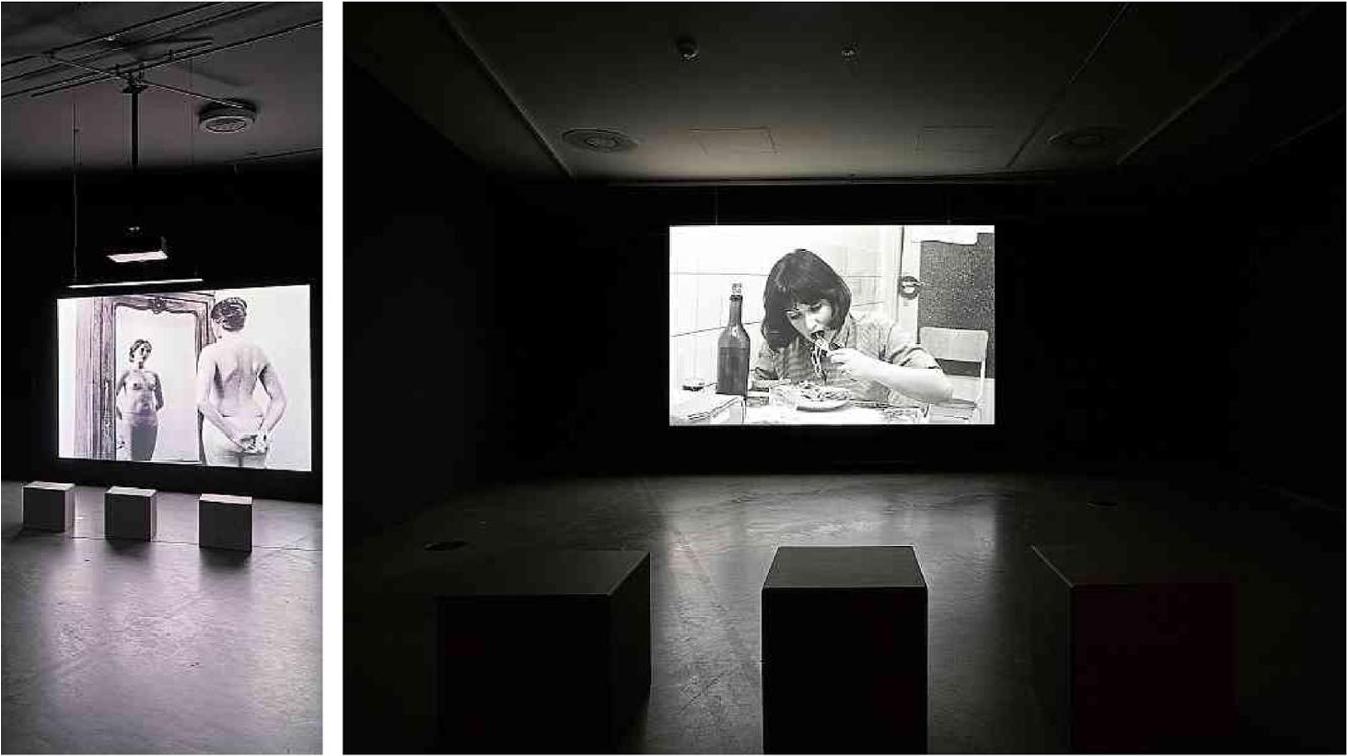
Fotos: Studio Hans Wilschut Courtesy Chantal Akerman Foundation and Maden Goodman Galiery, Paris
Subtiler Blickwinkel und eigener Stil
Ihr weiblicher Kamerablick wird besonders sichtbar in dem Film „Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles“, der bedauerlicherweise in Amsterdam nicht zu sehen ist. Tatsächlich sind drei Stunden und 21 Minuten über das eintönige Leben einer Prostituierten einem Museumsbesucher kaum zuzumuten. Aber es gibt von den letzten zehn Filmminuten eine Re-interpretation aus dem Jahr 2001 in Form einer Video-Installation, die das Eye vorführt. Mit der Filmversion von 1975 gelang Akerman der künstlerische Durchbruch. Bei Kennern gilt er als Meilenstein im Filmemachen überhaupt, vor allem, weil hier der Zuschauer unbewusst in die Rolle eines Teilnehmers schlüpft. Aber auch die anderen sieben Filme und Installationen, die das Eye zeigt, sind Kostbarkeiten aus Akermans Gesamtwerk. Darunter ist der Film „Hotel Monterey“, den sie als 21-Jährige während ihrer Reise nach New York drehte. Hier begegnete sie u. a. Andy Warhol, ließ sich inspirieren von der neuen Generation amerikanischer Regisseure und Filmproduzenten. Ihre Vielseitigkeit wiederum wird offenkundig in der Video-Installation „D’est, au bord de la fiction“, die auf dem Dokumentarfilm basiert, der 1993 auf einer Reise durch die ehemalige DDR, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei und Russland entstand. Immer wieder konfrontiert mit der eigene Familiengeschichte zeigt sie eine sich verändernde Welt.
Vermissen muss der Eye-Besucher typische Zeitdokumente aus Chantal Akermans Leben, erkennbar wird sie nur auf Leinwänden und Monitoren. Keine Kamera, mit der sie filmte, oder Fotos von ihren Wirkungsstätten. Keine Manuskripte oder Drehbücher. Kein persönliches Dokument, das den Menschen Akerman näherbringt. Zu lange Zeit blieb sie einem breiten Publikum fremd. Genau das wollte das Eye mit dieser Ausstellung ändern, wie Marnix van Wijk, Pressesprecher des Museums, betont. Doch dann kam die Corona-Pandemie und durchkreuzte diese Pläne. „Nun sind leider viel weniger Leute gekommen, da wir wegen der Abstandsregeln nur eine begrenzte Zahl Besucher zulassen dürfen. Auch die vielen internationalen Touristen, die in den Sommermonaten nach Amsterdam reisen, fehlen uns“, beklagt van Wijk. Dennoch hofft das Eye, bis zum Ausstellungsende zirka 25 000 Besucher zählen zu können.
Wie eingangs erwähnt durchzieht Akermans Arbeiten die Auseinandersetzung mit jüdischem Leben auf vielfältige und reflektierende Weise. Als Regisseurin und Drehbuchautorin gelingt es ihr, autobiografisches Material zum Stoff der Filme zu machen. Die Tochter polnisch-jüdischer Emigranten war prädestiniert dafür, weil ihr Blickwinkel subtiler und nuancierter war – auch für die Anzeichen eines wieder aufkeimenden Antisemitismus. Dass nun ihre Werke in Amsterdam gezeigt werden, erinnert an das Schicksal von Anne Frank, die hier im Exil lebte und ihre Todesfahrt in die Nazi-Vernichtungslager antrat. Hätte es zwischen Akerman und der jungen Tagebuchautorin eine Art Seelenverwandtschaft gegeben? Wir werden es leider nie erfahren.
»Chantal Akerman – Passages“, im Eye Filmmuseum, direkt am Kanalufer (Het 10 gegenüber dem Amsterdamer Hauptbahnhof gelegen. Es ist leicht mit einer kostenlosen Fähre zu erreichen. Eintrittspreis zu Wechselausstellungen: 15 Euro, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr. wv,w.eyefilm.nI
Filmografie
Folgende Filme und Video-Installationen werden in Amsterdam gezeigt:
.Saute ma ville“,1968,Schwarz/Weiß,13 Min., Inhalt: Wilde Aktionen in Mutters Küche mit Suizid am Ende.
„Hotel Monterey“, 1972, Farbe, 63 Min., ohne Ton, Inhalt: Aufnahmen in Manhattan, hinter jeder Tür eine Geschichte.
”D’Est, au bord de la fiction“, 1995, Farbe, Installation für 24 Monitore, Inhalt: Eindrücke von einer Reise nach Osteuropa.
„Woman sitting after killing“, 2001, Video-Installation für sieben Monitore, Inhalt: Zusammenstellung der letzten Sequenzen ihres Films „Jeanne Dielman“.
„Marcher à côté de ses lacets dans un frigidaire vide“, 2004, Inhalt: Eine spirale Projektion, Notizbuch über Aker-mans Familiengeschichte.
„In the mirror“, 2007, Kurzfilm, Inhalt: Eine junge Frau beschreibt sich selbst.
„Tombée de nuit sur Shanghai“, 2009, Video-Installation, Inhalt: Sonnenuntergang im Hafen, statische Bilder im Neonlicht,
„Now“, 2015, Video-Installation, Inhalt: Diese Abschlussdokumentation ist angelehnt an den Film „No Home Movie“, der das letzte Lebensjahr ihrer Mutter schildert.
Aktuelle Literatur „Chantal Akermans Verschwinden“ von Tine Rahel Völcker, Spector Books Leipzig. 2020, 160 Seiten. Entstehung und Inhalt von sieben ausgewählten Filmen werden hier beschrieben. Zur Akerman-Ausstellung hat das Eye einen ausführlichen Begleitband (160 Seiten) mit zahlreichen Fotos herausgegeben. Er enthält eine komplette Aufstellung ihrer Filme, Installationen und Bücher.
Donnerstag, den 7. November 2019 Die Warte PERSPECTIVES 29 I 2629 Luxemburger Wort
Die Warte
Gestaltung als Instrument des Bösen
,,Design im Dritten Reich“: Wie die Nazis die Massen manipulierten.
Von Rotger Kindermann
Wer über das Thema Design redet, denkt an modeme Gestaltung, an elegante Formen, an Schönheit von Grund auf. Namen wie der kürzlich verstorbene Colani, Le Corbusier, die Gebrüder Thonet oder der Modedesigner Pierre Cardin werden präsent. Der Name Adolf Hitler gehört bestimmt nicht in diese Kategorie. Auch nicht Joseph Goebbels, oberster Agitator im Dritten Reich als „Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda“, oder andere Nazi-Größen. Sie aber stehen synonym über einer Ausstellung, die sich einer sehr speziellen Design-Variante widmet, dem Design des Bösen und Teuflischen. Das Design Museum Den Bosch (im niederländischen s‘-Hertogenbosch) zeigt, wie im Dritten Reich durch Aufmachung, Muster und Choreographie die Menschen manipuliert wurden. Die Nationalsozialisten waren Meister darin, Design zu nutzen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Es wurde zu einem Instrument ihrer Macht. Nazi-Design prägte Gebrauchsartikel aller Art – von der Streichholzschachtel, dem Volksempfänger bis hin zum VW-Käfer. Nicht nur das Hakenkreuz war ein Beispiel dafür, wie kreative Formgebung in den Händen von Ideologen zum Symbol der Niedertracht wird.
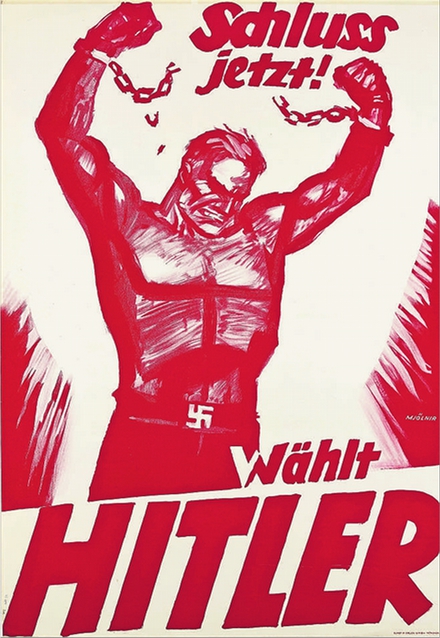
Angst vor Geschichtsrevisionisten?
Kein deutsches Museum hatte bisher den Mut, sich diesem brisanten Thema zu widmen. Geschah es aus Angst vor unerwünschten Besuchern aus dem AfD-Milieu, die noch heute den Holocaust leugnen? Fürchtete man Proteste von Geschichtsrevisionisten, wie sie seinerzeit bei der ,,Wehr- machtsaustellung“ (]995-2004) zutage traten? Es gab auch in s‘-Hertogenbosch ein paar Demonstranten, allerdings aus der linken Szene, die der Museumsleitung unterstellten, sie würde das Thema zu unkritisch darstellen. Davon kann keine Rede sein, auch wenn der Auftakt behutsam gestaltet ist. Direkt am Eingang erblickt der Besucher einen Volkswagen, die Urversion aus dem jahr 1943. Ein zwar winziges Auto, aber seine Lackierung in typischer Tarnfarbe verursacht schon eine Ahnung von militanter Gewalt. Der PKW – damals als KdF-Wagen bekannt – war das wichtigste Projekt der NS-Organisation ,,Kraft durch Freude“, die die Aufgabe hatte, die Freizeit der deutschen Arbeiter zu gestalten, zu überwachen und gleichzuschalten. Der Volkswagen ist ein prägnantes Beispiel für die Politik der Vereinnahmung, ideologisch propagiert als Belohnung für harte Arbeit zum Wohl der Volksgemeinschaft. Er sollte ein für jeden erschwingliches Massenprodukt werden, ein unhaltbares Versprechen, das zu Kriegsbeginn schnell wieder einkassiert wurde. Das für die damalige Zeit geradezu avantgardistische Design hat dazu beigetragen, dass der Käfer in dieser Form von 1938 bis 2003 gebaut wurde und nach wie vor das meistverkaufte Auto der Welt ist. Bemerkenswert ist auch, wie sich dieses Produkt von seiner NS-Vergangenheit befreien konnte.
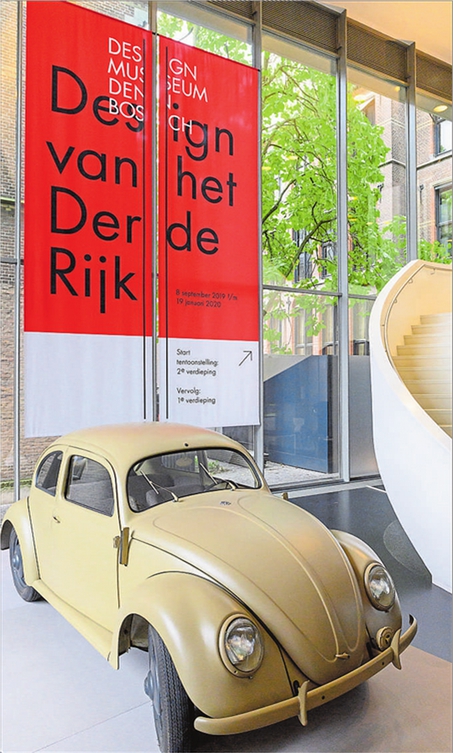
Aufruf zur Wachsamkeit
Nach diesem fast nostalgischen Einstieg in das Thema trifft den Besucher die ganze Wucht der Geschichte. Knallrote Fahnen, schwarze Hakenkreuze im weißen Kreis, Wahlkampfplakate mit Hitler, Fiihrerfotos mit jubelnden Menschenmassen. Schon nach ersten Eindrücken wird erkennbar, wie sehr die Nazis Design nutzten, um das Böse zu gestatten“, sagt Timo de Rijk, seit zwei Jahren Direktor des Design Museums. Aber wieso hat damals nur eine kleine Minderheit die frevelhaften Absichten hinter den medialen Inszenierungen bemerkt? Fast bei jedem gezeigten Nazi-Utensil, bei jedem Großbild von Parteitagen fragt. sich der Besucher, warum Menschen sich so einfach politisch verführen lassen. Deswegen ist die gesamte Ausstellung ein nachdrücklicher Aufruf zur Wachsamkeit.
Der Gestaltungs-Perfektionismus im Dritten Reich machte auch nicht halt vor Terror und Massenmord. Ein schauriges Beispiel ist der ,,Judenstern“, den alle Juden ab September 1941 öffentlich tragen mussten. Die Ausstellung zeigt verschiedene Design-Entwürfe, die zur Auswahl standen. Dieses Zwangskennzeichen war ein Vorbote für spätere Deportationen in die Vernichtungslager. Ob man allerdings die ausgestellten KZ-Baupläne – nur eine Abbildung primitiver Holzbaracken – unter Design-Perspektive betrachten soll, muss infrage gestellt werden.
Alle Lebensbereiche beeinflusst
Überall haben Nationalsozialisten versucht, Design als Propagandamittel zu verwenden. Auch deshalb kommuniziert die Ausstellung einen breit gefassten Design-Begriff. Er schließt die Architektur von Monumentalbauten, die Choreografie von Großdemonstrationen, Medien und Lehrbücher, Sportkleidung und Uniformen, ja selbst das „Design“ der ersten Autobahnen mit ein. Vermutlich lässt sich nur mit dieser Definition die allumfassende Beeinflussung durch Nazi-ldeologie anschaulich darstellen. Alle Lebensbereiche hatten sich ihr unterzuordnen, wobei Gigantismus, Perfektionismus und Fanatismus einen unheilvollen Einfluss hatten. Beim Design ist die Schriftart ein wichtiger Aspekt. Dazu zeigt das Museum ein interessantes Beispiel der gezielten ,Durchdringung und Gleichschaltung“. Ab 1933 wurde zunächst die ,,Fraktur“ zur verbindlichen Schrift erklärt, nur sie entspreche der deutschen Wesensart. 1941 wendete sich das Blatt, per Führerbefehl wurde die ,Antiqua“ angeordnet. Hitler glaubte, die eroberten Länder würden so ,leichter unsere Sprache lernen.“ Sie werde in 100 Jahren die einzige europäische Sprache sein. Es sind solche Details, die Ausstellungsbesucher immer wieder verblüffen und sprachlos machen.
Hunderte von kleinen und großen Objekten hat man in s‘-Hertogenbosch zusammengetragen, zum großen Teil Leihgaben aus deutschen Museen: Nazi-Geschirr, Riefenstahl-Filme, Hitler-Porträts, Skulpturen, Möbelstücke, etc. – allesamt Produkte aus einer Zeit, deren Grauen heute wieder verharmlost wird. Das Konzept der Ausstellung und die Erläuterungen lassen aber keinen Zweifel aufkommen, dass die Besucher ihre Botschaft verstehen. Zu hoffen bleibt auch, dass sich Museen in Deutschland nicht weiterhin vor diesem Thema scheuen.
,,Design im Dritten Reich“, bis 19. Januar 2020 im Design Museum Den Bosch. Erklärungen in Niederländisch, Englisch und Deutsch Umfangreiches Rdmenprogramm. mvw.designmuseum.nl

Vier Fragen an Timo de Rijk, Direktor des Design Museums Den Bosch
,,Design hat auch dem Bösen gedient“
Welche Erkenntnis hat Sie inspiriert, diese Ausstellung zu machen?
Wir versuchen im Museum, die Bedeutung von Design auf der Welt zu deuten, und wir müssen bei dieser Ausstellung erkennen, dass Design und die davon beeinflusste Kultur auch dem Bösen gedient haben. Dies ist eine ausdrückliche Korrektur der DesignGeschichte und auch ein Aufruf, um in Museen auf diese Weise mit Geschichte umzugehen.
Alle Diktaturen versuchen, ihre Inhalte mit einem politischen Design zu verbinden und zu vermitteln. Worin unterschieden sich dabei die Nationalsoziahsten in ihrer Vorgehensweise?
Das Auffälligste m der Zeit des Nationalsozialismus ist die Kombination einer reaktionären rassistischen Ideologie mit modernsten Mitteln. Das lässt sich gut feststellen im Transportbereich beispielsweise bei Flugzeugen oder Zeppelinen, aber auch bei der Kommunikation, wenn wir an Radiosendungen und Tonfilme denken. Die radikale und penetrante Beeinflussung aller Lebensbereiche war hier besonders extrem.
Welche Einsicht sollte ein Ausstellungsbesucher mit nach Hause nehmen?
Wir erwarten dass Kultur das Gute repräsentiert. Leider müssen wir aber feststellen, dass die Zusammenhänge zwischen Gut und Schlecht sowie Schön und Hässlich viel komplizierter sind, als wir dachten. Die diesbezügliche Verwirrung ist vielleicht die beste und kritischste Botschaft, die ich unseren Besuchern mit auf den Weg geben kann.
Was wissen Sie über die Reaktionen der Besucher? Entsprechen die Zahlen und die Zsammensetzung Ihren Erwartungen?
Ich kann nichts anderes sagen, als dass uns die Vielfalt des Publikums und die Aufmerksamkeit, mit der es schaut und zuhört, bewegen. Die Reaktionen sind durchaus nuanciert und wir merken, dass die Botschaft gut aufgegriffen wird. Wir sind jeden Tag ausverkauft und wenn wir das so fortsetzen können, werden meine Erwartungen noch übertroffen. RK